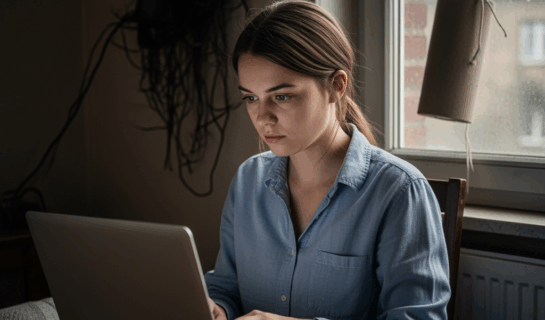Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Digitaler Türspion: Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern im Fokus
- Der Fall vor Gericht
- Digitaler Türspion im Mehrfamilienhaus verletzt Persönlichkeitsrechte der Nachbarn
- Überwachung gemeinschaftlicher Bereiche bedarf der Zustimmung
- Grundsätzliche Unzulässigkeit von Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen
- Rechtliche Bewertung des digitalen Türspions
- Mögliche Ausnahmen durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann darf ein digitaler Türspion in einer Eigentumswohnung installiert werden?
- Welche Rechte haben Nachbarn bei unerlaubter Installation eines digitalen Türspions?
- Welche Bereiche dürfen von einem digitalen Türspion erfasst werden?
- Was ist der rechtliche Unterschied zwischen einem klassischen und einem digitalen Türspion?
- Welche Kosten können bei einem Rechtsstreit um einen digitalen Türspion entstehen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Karlsruhe
- Datum: 17.05.2024
- Aktenzeichen: 11 S 163/23
- Verfahrensart: Berufung in einem Wohnungseigentumsverfahren
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Zivilrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine Gruppe von Wohnungseigentümern. Ihre Argumente betrafen die Beseitigung eines digitalen Türspions, der auf Gemeinschaftsflächen ausgerichtet war und ihr Persönlichkeitsrecht verletzen könnte.
- Beklagter: Ein Wohnungseigentümer mit einem digitalen Türspion. Sein Argument war, dass der Türspion keine dauerhafte Speicherung ermöglicht und keine Signalweitergabe an andere Geräte erfolgt. Dennoch wurde seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil zurückgewiesen.
Um was ging es?
- Sachverhalt: Der Beklagte hatte einen digitalen Türspion angebracht, der den gemeinschaftlichen Hausflur erfasste. Die Kläger sahen darin eine Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte, da der Türspion auch ohne dauerhafte Aufnahme die Privatsphäre beeinträchtigen könne.
- Kern des Rechtsstreits: Ob der Beklagte berechtigt ist, den digitalen Türspion ohne Zustimmung der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu nutzen.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Berufung des beklagten Wohnungseigentümers wurde zurückgewiesen. Der Beklagte muss den digitalen Türspion entfernen und anteilige vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten erstatten.
- Begründung: Die Entscheidung basiert auf dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Kläger. Die Veränderung des Gemeinschaftseigentums durch den digitalen Türspion bedarf der Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft.
- Folgen: Der Beklagte muss die Kosten des Berufungsverfahrens tragen. Die Entscheidung verdeutlicht, dass bauliche Veränderungen, die die Persönlichkeitsrechte anderer Eigentümer beeinträchtigen könnten, der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft bedürfen. Weitere Rechtsmittel wurden nicht eingelegt; das Urteil ist daher endgültig.
Digitaler Türspion: Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern im Fokus
Der Einbau digitaler Türspione in Mehrparteienhäuser wirft zahlreiche rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsrecht auf. Wohnungseigentümer haben das Recht, ihre technischen Ausstattung zu modernisieren, etwa durch intelligente Türkommunikationssysteme, doch diese baulichen Veränderungen erfordern in der Regel die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Um sicherzustellen, dass alle Mieter und Eigentümer die neuen Technologien unterstützen, sind die Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) zu beachten.
Zusätzlich stehen Aspekte des Datenschutzes und der digitalen Sicherheitstechnik im Fokus, da moderne Türüberwachungssysteme tiefer in die Privatsphäre eingreifen können. Der vorliegende Beitrag beleuchtet einen konkreten Fall, der aufzeigt, welche rechtlichen Schritte notwendig sind, um den Einbau eines digitalen Türspions genehmigen zu lassen und welche Rechte die Wohnungseigentümer in diesem Zusammenhang haben.
Der Fall vor Gericht
Digitaler Türspion im Mehrfamilienhaus verletzt Persönlichkeitsrechte der Nachbarn

Das Landgericht Karlsruhe hat in einem Rechtsstreit über einen digitalen Türspion die Installation dieser technischen Einrichtung im Mehrfamilienhaus als unzulässig eingestuft. Die Richter bestätigten damit das Urteil der Vorinstanz, wonach der beklagte Wohnungseigentümer den digitalen Türspion entfernen und anteilige Anwaltskosten erstatten muss.
Überwachung gemeinschaftlicher Bereiche bedarf der Zustimmung
Der Fall dreht sich um die eigenmächtige Installation eines digitalen Türspions durch einen Wohnungseigentümer. Das Gerät ermöglichte die Erfassung des gemeinschaftlichen Hausflurs vor der Wohnungstür. Obwohl die Kamera keine dauerhafte Speicherungsfunktion besaß und Signale nicht an andere Geräte weitergegeben werden konnten, sahen die Richter darin einen Eingriff in die Privatsphäre der Nachbarn. Die Wohnungseingangstür gehört zum Gemeinschaftseigentum, weshalb deren Veränderung durch den Austausch des Türspions der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft bedurft hätte.
Grundsätzliche Unzulässigkeit von Videoüberwachung in Gemeinschaftsbereichen
Das Gericht verwies auf die ständige Rechtsprechung, nach der die Videoüberwachung von gemeinschaftlich genutzten Bereichen in Mehrfamilienhäusern grundsätzlich unzulässig ist. Dies betrifft den Außenbereich vor dem Eingang, das Treppenhaus, den Aufzug, die gemeinschaftliche Waschküche, die Tiefgarage und sonstige allgemein zugängliche Außenbereiche. Eine solche Überwachung stelle eine ständige Kontrolle der betroffenen Personen in ihrer privaten Lebensführung dar.
Rechtliche Bewertung des digitalen Türspions
Nach Auffassung des Gerichts ist bereits die vorübergehende, automatisch vergängliche Aufnahme durch den digitalen Türspion als Eingriff in die „Achtung der Privatsphäre“ zu werten. Die klagenden Nachbarn können sich auf ihr Allgemeines Persönlichkeitsrecht berufen und die Beseitigung des Türspions verlangen. Dieser Anspruch besteht, solange die Bauliche Veränderung nicht durch einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft legitimiert wird.
Mögliche Ausnahmen durch Beschluss der Eigentümergemeinschaft
Das Gericht räumte ein, dass digitale Türspione in vielen Wohnanlagen verbreitet sind. Die Eigentümerversammlung hat im Rahmen ihrer Ermessensfreiheit die Möglichkeit, die Nutzung dieser technischen Entwicklung für einzelne oder alle Eigentümer zuzulassen. Bei einer solchen Beschlussfassung können die jeweiligen Rechte und Interessen der verschiedenen Wohnungseigentümer gegeneinander abgewogen werden, etwa wenn wie im vorliegenden Fall eine Sehbeeinträchtigung des Bewohners vorliegt.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Landgericht Karlsruhe hat entschieden, dass digitale Türspione mit Kamerafunktion, die den gemeinschaftlichen Hausflur erfassen, grundsätzlich unzulässig sind. Dies gilt besonders dann, wenn sie Aufzeichnungen ermöglichen oder per Smartphone Bild- und Tonübertragungen empfangen können. Das Urteil stärkt das Persönlichkeitsrecht der Mitbewohner und bestätigt, dass jeder Wohnungseigentümer einen individuellen Anspruch hat, gegen solche Beeinträchtigungen vorzugehen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Wenn Ihr Nachbar einen digitalen Türspion installiert hat, der den Hausflur überwacht, können Sie dagegen rechtlich vorgehen – auch als einzelner Bewohner. Sie müssen solche Überwachung in Ihrem privaten Umfeld nicht dulden, da sie Ihr Recht auf Privatsphäre verletzt. Die Kosten für die Beseitigung und eventuell entstehende Anwaltskosten muss der Verursacher tragen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Kamera tatsächlich aufzeichnet oder nur live überträgt – bereits die Möglichkeit der Überwachung ist unzulässig.
Ihr Recht auf Privatsphäre im Mehrfamilienhaus
Das Urteil des Landgerichts Karlsruhe zeigt, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre im eigenen Zuhause ist. Fühlen Sie sich durch die Überwachungstechnik Ihres Nachbarn ebenfalls beeinträchtigt? Die Installation eines digitalen Türspions, der den Hausflur filmt, verletzt Ihre Persönlichkeitsrechte, selbst wenn keine Aufzeichnungen erfolgen. Gerne helfen wir Ihnen, Ihre Rechte durchzusetzen und die unzulässige Überwachung zu beenden.
✅ Fordern Sie unsere Ersteinschätzung an!
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann darf ein digitaler Türspion in einer Eigentumswohnung installiert werden?
Die Installation eines digitalen Türspions in einer Eigentumswohnung erfordert zwingend die vorherige Gestattung durch die Wohnungseigentümergemeinschaft. Dies gilt auch für einfache Geräte ohne Speicherfunktion oder Signalweitergabe.
Voraussetzungen für die Installation
Ein rechtmäßiger Einbau ist nur möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Bildübertragung erfolgt ausschließlich nach dem Klingeln
- Eine dauerhafte Speicherung der Aufnahmen ist ausgeschlossen
- Das Sichtfeld ist räumlich nicht größer als bei einem herkömmlichen Türspion
- Die Übertragung endet nach wenigen Sekunden automatisch
Beschlussfassung der WEG
Die Installation erfordert einen qualifizierten Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Ohne einen entsprechenden Beschluss stellt der Einbau eines digitalen Türspions eine unzulässige bauliche Veränderung dar.
Rechtliche Konsequenzen bei unerlaubter Installation
Wenn Sie einen digitalen Türspion ohne Genehmigung installieren, können andere Eigentümer die sofortige Entfernung verlangen. Dies gilt selbst dann, wenn besondere Sicherheitsbedürfnisse vorliegen oder die Aufnahmen zeitnah gelöscht werden.
Besondere Umstände
Die Eigentümerversammlung kann bei ihrer Beschlussfassung besondere Umstände berücksichtigen, wie etwa:
- Sehbehinderungen der Bewohner
- Erhöhte Sicherheitsbedürfnisse
- Die technische Ausführung der Installation
Der digitale Türspion darf in keinem Fall den gemeinschaftlichen Hausflur überwachen oder die Persönlichkeitsrechte der Nachbarn verletzen. Die Installation muss so erfolgen, dass sie keine wesentliche bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum verursacht.
Welche Rechte haben Nachbarn bei unerlaubter Installation eines digitalen Türspions?
Bei einer unerlaubten Installation eines digitalen Türspions steht Nachbarn ein sofortiger Unterlassungsanspruch zu. Dieser Anspruch basiert auf §§ 1004, 823 BGB in Verbindung mit dem grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrecht.
Rechtliche Grundlagen der Ansprüche
Der Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn die bloße Möglichkeit einer Überwachung gegeben ist. Ein Nachweis tatsächlicher Aufnahmen ist nicht erforderlich, da allein der entstehende Überwachungsdruck ausreicht. Dies gilt selbst dann, wenn die Kamera nur bei Betätigung der Türklingel aktiviert wird oder keine Aufnahmen speichert.
Durchsetzung der Ansprüche
Die Nachbarn können die sofortige Entfernung der Kamera und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangen. Dieser Anspruch gilt unabhängig davon, ob:
- die Kamera nur temporär aufzeichnet
- besondere Sicherheitsbedürfnisse vorliegen
- die Aufnahmen zeitnah gelöscht werden
Besonderheiten in Mehrparteienhäusern
In Mehrfamilienhäusern wiegt der Eingriff besonders schwer. Das Amtsgericht Bergisch Gladbach hat entschieden, dass digitale Türspione einen widerrechtlichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der anderen Mietparteien darstellen. Die Nachbarn können sich auf § 15 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) berufen, wonach die Nutzung des Gemeinschaftseigentums nicht zu einer Beeinträchtigung anderer Eigentümer führen darf.
Die betroffenen Nachbarn können ihre Ansprüche notfalls gerichtlich durchsetzen. Ein nachträglicher Beschluss der Eigentümerversammlung kann die Installation nur dann legitimieren, wenn dieser einstimmig erfolgt, da wesentliche Rechte der Miteigentümer betroffen sind.
Welche Bereiche dürfen von einem digitalen Türspion erfasst werden?
Ein digitaler Türspion darf ausschließlich den unmittelbaren Eingangsbereich vor der eigenen Wohnungstür erfassen. Der Erfassungsbereich muss dabei dem eines herkömmlichen, optischen Türspions entsprechen.
Räumliche Einschränkungen
Die Kamera darf keinesfalls öffentliche Bereiche, Nachbargrundstücke oder gemeinschaftliche Zugangswege miterfassen. Sobald Gemeinschaftseigentum wie Hausflure oder Treppenhäuser im Erfassungsbereich liegen, liegt eine unzulässige Überwachung vor.
Technische Vorgaben
Die Bildübertragung muss streng anlassbezogen erfolgen und darf nur nach Betätigung der Klingel aktiviert werden. Nach wenigen Sekunden muss sich die Übertragung automatisch abschalten. Eine dauerhafte Bildübertragung oder Aufzeichnung ist nicht gestattet.
Besonderheiten im Gemeinschaftseigentum
Wenn Sie in einer Wohnungseigentümergemeinschaft leben, benötigen Sie für die Installation eines digitalen Türspions grundsätzlich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Dies gilt auch dann, wenn die Kamera nur den unmittelbaren Bereich vor der eigenen Wohnungstür erfasst, da der Hausflur zum Gemeinschaftseigentum gehört.
Der Erfassungsbereich muss so eingestellt sein, dass er räumlich nicht mehr abbildet als ein Blick durch einen herkömmlichen Türspion. Eine Überwachung von Gemeinschaftsflächen wie Treppenhäuser oder Flure ist unzulässig, da dies einen widerrechtlichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der anderen Hausbewohner darstellt.
Was ist der rechtliche Unterschied zwischen einem klassischen und einem digitalen Türspion?
Der klassische Türspion ist rechtlich unproblematisch, da er lediglich eine optische Durchsicht ermöglicht. Der digitale Türspion hingegen unterliegt strengen rechtlichen Einschränkungen, da er als elektronisches Überwachungsgerät eingestuft wird.
Rechtliche Einordnung des digitalen Türspions
Ein digitaler Türspion stellt einen widerrechtlichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Hausbewohner dar, wenn er Bereiche erfasst, die nicht zum eigenen Sondereigentum gehören. Dies gilt selbst dann, wenn keine dauerhafte Speicherung der Aufnahmen erfolgt oder die Kamera nur bei Betätigung der Türklingel aktiviert wird.
Genehmigungspflicht
Während ein klassischer Türspion ohne Weiteres installiert werden darf, benötigt ein digitaler Türspion in einer Wohnungseigentümergemeinschaft die ausdrückliche Zustimmung der WEG-Gemeinschaft. Die Wohnungseingangstür gehört zum Gemeinschaftseigentum, weshalb ihre Veränderung durch einen digitalen Türspion der gemeinschaftlichen Genehmigung bedarf.
Überwachungsdruck als rechtliches Problem
Ein wesentlicher rechtlicher Unterschied besteht im sogenannten Überwachungsdruck. Während der klassische Türspion nur bei aktiver Nutzung funktioniert, können sich Nachbarn beim digitalen System einem permanenten Überwachungsgefühl ausgesetzt sehen. Dies verletzt bereits dann das Persönlichkeitsrecht, wenn Mieter und andere Eigentümer allein durch das Vorhandensein der Türkamera einem subjektiven Überwachungsdruck ausgesetzt sind.
Datenschutzrechtliche Aspekte
Der klassische Türspion unterliegt keinerlei datenschutzrechtlichen Vorgaben. Der digitale Türspion muss hingegen die Anforderungen der DSGVO erfüllen, wenn er personenbezogene Daten verarbeitet. Die Verarbeitung muss fair, legal und transparent erfolgen, was beim klassischen Türspion keine Rolle spielt.
Welche Kosten können bei einem Rechtsstreit um einen digitalen Türspion entstehen?
Bei einem Rechtsstreit um einen digitalen Türspion richten sich die Kosten nach dem Streitwert, der vom Gericht festgelegt wird. Ein typischer Streitwert in solchen Fällen liegt bei etwa 4.000 Euro.
Anwaltskosten
Die Anwaltsgebühren werden nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet. Bei einem Streitwert von 4.000 Euro fallen folgende Gebühren an:
- Eine Grundgebühr von 1.009 Euro
- Eine 1,3-fache Verfahrensgebühr für die Prozessführung
- Eine 1,2-fache Termingebühr für Gerichtstermine
Gerichtskosten
Die Gerichtskosten setzen sich aus den gerichtlichen Gebühren und Auslagen zusammen. Diese beinhalten:
- Grundgebühren nach dem Gerichtskostengesetz
- Kosten für eventuelle Zeugen und Sachverständige
- Auslagen für Porto und Kommunikation
Kostenverteilung
Die Kostentragung richtet sich nach dem Ausgang des Verfahrens. Wenn Sie den Prozess verlieren, müssen Sie:
- Die eigenen Anwaltskosten
- Die gegnerischen Anwaltskosten
- Sämtliche Gerichtskosten tragen
Besondere Kostenfaktoren
Bei Streitigkeiten in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) können zusätzliche Kosten entstehen:
- Kosten für Eigentümerversammlungen
- Verwaltungskosten für die Durchsetzung von Beschlüssen
- Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands der Tür
Die Gesamtkosten eines solchen Rechtsstreits können sich bei einem Streitwert von 4.000 Euro auf etwa 3.000 bis 4.000 Euro belaufen, wenn alle Instanzen durchlaufen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Bauliche Veränderung
Eine dauerhafte Umgestaltung oder Erweiterung des Gebäudes oder der Wohnanlage, die über bloße Instandhaltung oder Reparatur hinausgeht. Nach § 20 WEG kann jeder Wohnungseigentümer solche Maßnahmen am gemeinschaftlichen Eigentum verlangen, wenn sie die Wohnanlage modernisieren oder barrierefrei machen. Beispiele sind der Einbau eines Aufzugs, Balkons oder einer Solaranlage. Bei baulichen Veränderungen muss immer zwischen den Interessen der Eigentümer und der Erhaltung der Bausubstanz abgewogen werden.
Gemeinschaftseigentum
Die Teile, Anlagen und Einrichtungen eines Mehrfamilienhauses, die nicht im Sondereigentum stehen und dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungseigentümer dienen (§ 1 Abs. 5 WEG). Dazu gehören typischerweise das Treppenhaus, Außenwände, Dach, Heizungsanlage oder Hauseingang. Veränderungen am Gemeinschaftseigentum erfordern grundsätzlich die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft durch Beschluss. Die Kosten für Instandhaltung und Modernisierung tragen alle Eigentümer gemeinsam.
Eigentümergemeinschaft
Der Zusammenschluss aller Wohnungseigentümer in einem Mehrfamilienhaus, die gemeinsam das Gebäude verwalten (§ 1 WEG). Sie trifft wichtige Entscheidungen durch Beschlüsse auf der Eigentümerversammlung, etwa zu Renovierungen oder der Hausordnung. Die Gemeinschaft wird nach außen durch den Verwalter vertreten und kann eigene Rechte geltend machen. Jeder Eigentümer ist automatisch Mitglied und muss sich an Beschlüsse halten.
Allgemeines Persönlichkeitsrecht
Ein durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz geschütztes Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Es umfasst unter anderem das Recht am eigenen Bild, den Schutz der Privatsphäre und die informationelle Selbstbestimmung. Im Wohnungseigentumsrecht spielt es besonders bei Überwachungsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Eingriffe sind nur mit Einwilligung oder aufgrund überwiegender schutzwürdiger Interessen zulässig.
Eigentümerversammlung
Das zentrale Beschlussorgan der Wohnungseigentümergemeinschaft nach § 23 WEG. Hier werden durch Mehrheitsbeschluss wichtige Entscheidungen für die Gemeinschaft getroffen, etwa über Instandhaltungsmaßnahmen oder die Hausordnung. Die Versammlung muss mindestens einmal jährlich stattfinden. Jeder Eigentümer hat Teilnahme- und Stimmrecht entsprechend seinem Miteigentumsanteil. Beschlüsse sind für alle Eigentümer bindend.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 1004 BGB (Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch):
Nach § 1004 Abs. 1 BGB kann der Eigentümer die Beseitigung oder Unterlassung von Beeinträchtigungen verlangen, die durch einen anderen verursacht werden. Eine solche Beeinträchtigung liegt insbesondere vor, wenn das gemeinschaftliche Eigentum durch bauliche Maßnahmen wie die Installation eines digitalen Türspions verändert wird, ohne dass die notwendige Zustimmung der Eigentümergemeinschaft eingeholt wurde.
Im vorliegenden Fall betrifft die Installation des Türspions das gemeinschaftliche Eigentum, konkret die Wohnungseingangstür, was den Beseitigungsanspruch der anderen Wohnungseigentümer auslöst, da diese nicht genehmigt wurde und das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Nachbarn beeinträchtigt. - § 14 Abs. 2 Nr. 1 WEG (Pflichten des Wohnungseigentümers):
Wohnungseigentümer dürfen keine baulichen Veränderungen vornehmen, die Rechte anderer Wohnungseigentümer beeinträchtigen, es sei denn, diese wurden durch die Gemeinschaft beschlossen oder ausdrücklich genehmigt. Das Gesetz schützt dabei insbesondere das Recht auf ungestörte Nutzung des gemeinschaftlichen Eigentums.
Im Fall wurde die bauliche Veränderung, nämlich die Installation eines digitalen Türspions mit Kamerafunktion, ohne Genehmigung vorgenommen und beeinträchtigt die anderen Eigentümer in ihrem Recht auf Privatsphäre. - Allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG):
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt den Einzelnen vor Überwachung und vor der unberechtigten Aufzeichnung von Bildern und Daten. Insbesondere Gemeinschaftsflächen, die von allen Bewohnern genutzt werden, dürfen nicht ohne deren Zustimmung videoüberwacht werden, um eine ständige Kontrolle zu vermeiden.
Der digitale Türspion verletzt dieses Recht, da er den gemeinschaftlichen Flur vor der Wohnungstür überwacht und damit die Privatsphäre der Nachbarn einschränkt, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Aufzeichnung stattfindet. - § 20 Abs. 1 WEG (Bauliche Veränderungen):
Veränderungen am gemeinschaftlichen Eigentum bedürfen der Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft, es sei denn, sie sind von so geringfügiger Natur, dass keine Beeinträchtigungen der Rechte anderer Eigentümer zu erwarten sind. Ohne Beschlussfassung oder Zustimmung handelt es sich um eine unzulässige bauliche Veränderung.
Im vorliegenden Fall wurde die bauliche Veränderung durch den digitalen Türspion ohne Genehmigung vorgenommen, was einen Verstoß gegen diese Vorschrift darstellt, da die Installation erhebliche Auswirkungen auf die Rechte der anderen Eigentümer hat. - Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG (Diskriminierungsverbot und Schutz für Menschen mit Behinderungen):
Das Grundgesetz verlangt einen besonderen Schutz von Menschen mit Behinderungen und erlaubt gegebenenfalls Maßnahmen, die eine barrierefreie Nutzung ermöglichen. Diese müssen jedoch im Einzelfall abgewogen werden, um die Rechte anderer nicht unverhältnismäßig einzuschränken.
Im Fall wird zwar auf eine mögliche Sehbeeinträchtigung des Beklagten verwiesen, jedoch wurde keine Abwägung der Rechte vorgenommen, und die Maßnahme bleibt ungenehmigt. Eine angemessene Lösung hätte durch einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft herbeigeführt werden müssen.
Das vorliegende Urteil
LG Karlsruhe – Az.: 11 S 163/23 – Urteil vom 17.05.2024
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.