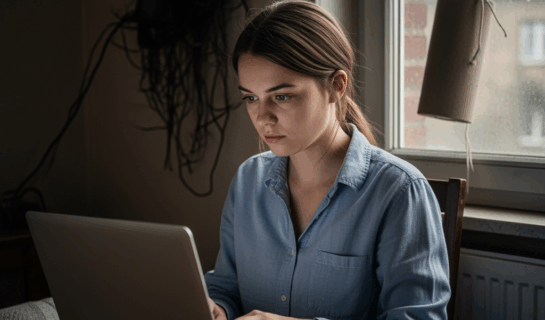Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Was passiert, wenn sich Wohnungseigentümer nicht auf einen Hausverwalter einigen können?
- Worum genau ging es in diesem Fall?
- Wie kam es zur Gerichtsverhandlung?
- Was forderten die unterlegenen Eigentümer vom Gericht?
- Wie verteidigte sich die Eigentümerin mit der Stimmenmehrheit?
- Wie hat das Gericht entschieden?
- Warum hat das Gericht überhaupt einen Verwalter eingesetzt?
- Warum wurde Herr C ausgewählt, aber nur für ein Jahr?
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche konkreten Schritte kann ich als Wohnungseigentümer einleiten, wenn unsere WEG keinen Verwalter findet oder sich nicht einigen kann?
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gericht einen Not-Verwalter für eine Wohnungseigentümergemeinschaft bestellen?
- Was bedeutet ordnungsgemäße Verwaltung für eine WEG und warum ist sie für die Verwalterbestellung entscheidend?
- Was kann ich tun, wenn ein Mehrheitseigentümer die Bestellung eines Verwalters systematisch blockiert?
- Welche Faktoren beeinflussen die Dauer der gerichtlichen Bestellung eines WEG-Verwalters?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 27 C 52/18 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: AG Bonn
- Datum: 16.08.2018
- Aktenzeichen: 27 C 52/18
- Verfahren: Klageverfahren
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Wohnungseigentümer, die die Ablehnung einer Verwalterbestellung als Verstoß gegen die Ordnungsgemäße Verwaltung ansahen. Sie warfen der Beklagten Stimmrechtsmissbrauch und Blockade der Verwalterbestellung vor und beantragten die gerichtliche Bestellung eines Verwalters, vorrangig Herrn C, für vier Jahre.
- Beklagte: Wohnungseigentümer mit Stimmrechtsmehrheit, die die Klageabweisung beantragten. Sie argumentierten, es habe keine ausreichende Vorbefassung gegeben und Herr C habe keine Alternativvorschläge eingeholt; zudem fehle das Vertrauen zu Herrn C.
Worum ging es genau?
Die Wohnungseigentümergemeinschaft konnte sich nicht auf die Bestellung eines Verwalters einigen, nachdem der vorherige gerichtlich bestellte Verwalter ausschied und die zuvor bestellte GbR für ungeeignet erklärt wurde. Die Kläger beantragten daraufhin die gerichtliche Bestellung eines neuen Verwalters.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
Besteht ein Anspruch der Wohnungseigentümer auf gerichtliche Bestellung eines Verwalters, wenn die Gemeinschaft selbst keinen Beschluss fasst, und welche Kriterien sind dabei für die Auswahl des Verwalters maßgeblich, insbesondere hinsichtlich der Eignung, der Notwendigkeit von Alternativangeboten und der Dauer der Bestellung?
Wie hat das Gericht entschieden?
- Klage teilweise stattgegeben, teilweise abgewiesen: Das Gericht bestellte einen Verwalter, wies jedoch den Antrag auf eine vierjährige Bestellungsdauer ab.
- Kernaussagen der Begründung:
- Anspruch auf Verwalterbestellung bejaht: Das Gericht bestätigte, dass ein Anspruch auf die Bestellung eines Verwalters als Maßnahme ordnungsgemäßer Verwaltung besteht und bei fehlendem Beschluss der Gemeinschaft eine gerichtliche Bestellung möglich ist.
- Keine Alternativangebote durch gerichtlich bestellten Verwalter erforderlich: Bei der Wiederbestellung eines amtierenden, gerichtlich bestellten Verwalters ist es nicht dessen Aufgabe, Alternativangebote einzuholen; dies obliegt den Wohnungseigentümern selbst oder dem Verwaltungsbeirat.
- Gerichtliches Ermessen bei Bestellungsdauer: Das Gericht bestellte den bereits gerichtlich eingesetzten Verwalter Herrn C für ein weiteres Jahr, da er eingearbeitet und neutral sei und seine Konditionen günstig waren. Eine sofortige Bestellung für die gesetzliche Höchstdauer von vier Jahren wurde als nicht zwingend erforderlich abgelehnt.
- Argumente der Beklagten verworfen: Die Einwände der Beklagten, es habe an der Vorbefassung gemangelt oder der Verwalter Herr C sei ungeeignet oder hätte Alternativangebote einholen müssen, wurden vom Gericht zurückgewiesen.
- Folgen für die Klägerin/den Kläger:
- Der vom Gericht bereits früher bestellte Verwalter Herr C wurde für ein weiteres Jahr bis zum 15.08.2019 zum WEG-Verwalter bestellt.
- Der weitergehende Antrag auf Bestellung für vier Jahre wurde abgewiesen.
- Die Kosten des Rechtsstreits wurden zwischen den Parteien aufgehoben, d.h., jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
Der Fall vor Gericht
Was passiert, wenn sich Wohnungseigentümer nicht auf einen Hausverwalter einigen können?
Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren anderen Eigentümern. Damit alles rund läuft – von der Organisation der Müllabfuhr über die Buchhaltung bis hin zur Planung von Reparaturen – braucht es einen Hausverwalter. Doch was geschieht, wenn die Eigentümergemeinschaft so zerstritten ist, dass sie sich nicht auf eine Person oder eine Firma für diesen wichtigen Job einigen kann? Genau mit dieser Frage musste sich das Amtsgericht Bonn in einem Urteil befassen. Es ging um eine Pattsituation, in der eine einzelne Eigentümerin mit ihrer Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwalters blockierte und die anderen Eigentümer das Gericht um Hilfe baten.
Worum genau ging es in diesem Fall?

In einer Bonner Wohnungseigentümergemeinschaft (kurz WEG), bestehend aus acht Einheiten mit Wohnungen und Arztpraxen, herrschte dicke Luft. Das Stimmrecht in dieser Gemeinschaft richtete sich nach den Miteigentumsanteilen (MEA). Stellen Sie sich das wie Aktien an einem Unternehmen vor: Wer einen größeren Anteil am gesamten Haus besitzt, dessen Stimme hat bei Abstimmungen mehr Gewicht. In diesem Fall besaß eine einzelne Eigentümerin, die Beklagte, die Mehrheit der Stimmen und konnte somit alle Entscheidungen dominieren.
Das Problem begann, als klar wurde, dass der bisherige Verwalter, eine sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), aus rechtlichen Gründen gar nicht als Verwalter hätte tätig sein dürfen. Dies hatte der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Zivilgericht, in einem früheren Urteil entschieden. Daraufhin hatte das Amtsgericht Bonn bereits in einem früheren Verfahren einen Not-Verwalter eingesetzt: Herrn C, der für sechs Monate die Geschäfte führen sollte, bis die Eigentümer einen neuen, regulären Verwalter wählen.
Wie kam es zur Gerichtsverhandlung?
Der vom Gericht eingesetzte Herr C lud, wie es seine Aufgabe war, zu einer Eigentümerversammlung ein. Auf der Tagesordnung stand der wichtigste Punkt: die Wahl eines neuen Verwalters. Der Vorschlag lautete, Herrn C selbst für die Dauer von vier Jahren zu bestellen. Doch es kam, wie es kommen musste: Die Eigentümerin mit der Stimmenmehrheit lehnte diesen Vorschlag ab. Die übrigen Eigentümer stimmten dafür. Das Ergebnis war ein klares Nein.
Die unterlegenen Eigentümer (die Kläger) sahen darin eine bewusste Blockade. Sie waren der Meinung, die Mehrheitseigentümerin wolle nur ihren alten, ungeeigneten Verwalter zurück, obwohl dessen Unzulässigkeit gerichtlich festgestellt war. Sie fühlten sich von der Mehrheitseigentümerin majorisiert, also durch deren Stimmengewicht systematisch überstimmt. Deshalb zogen sie vor Gericht.
Was forderten die unterlegenen Eigentümer vom Gericht?
Die Kläger hatten zwei Hauptziele. Erstens wollten sie, dass das Gericht diesen „Nein“-Beschluss für ungültig erklärt. Juristen nennen das die Anfechtung eines Negativbeschlusses – also eines Beschlusses, bei dem ein Antrag abgelehnt wurde.
Zweitens, und das war das eigentliche Ziel, beantragten sie, dass das Gericht selbst einen Verwalter bestimmt. Das Gesetz sah damals eine solche Möglichkeit vor (§ 21 Abs. 8 WEG alte Fassung), wenn die Eigentümer es selbst nicht schaffen, eine für die ordnungsgemäße Verwaltung notwendige Entscheidung zu treffen. Und die Bestellung eines Verwalters ist die Grundlage jeder ordnungsgemäßen Verwaltung. Dieser Begriff bedeutet im Grunde, dass alles so gehandhabt werden muss, wie es ein vernünftiger und wirtschaftlich denkender Eigentümer tun würde.
Die Kläger schlugen dem Gericht vor, Herrn C für vier Jahre zu bestellen. Sie begründeten dies damit, dass die von der Mehrheitseigentümerin bevorzugte alte Verwaltung (die U GbR und deren Gesellschafter Herr L) nachweislich ungeeignet sei. Sie zählten eine lange Liste von Verfehlungen auf: von fehlender Buchhaltungssoftware über falsche Abrechnungen bis hin zur Abhaltung von Versammlungen in einer Kneipe.
Wie verteidigte sich die Eigentümerin mit der Stimmenmehrheit?
Die Beklagte forderte, die Klage abzuweisen. Ihre Argumentation stützte sich auf zwei Hauptpunkte:
- Fehlende Alternativen: Sie argumentierte, die Abstimmung sei nicht korrekt vorbereitet worden. Den Eigentümern wurde nur Herr C als einzige Option präsentiert. Es gab keine Vergleichsangebote von anderen Verwaltungen. Eine „Friss oder stirb“-Entscheidung entspreche nicht den Regeln einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Bei einer Neubestellung, so ihre Ansicht, müssten immer mindestens drei Angebote vorliegen.
- Fehlendes Vertrauen: Sie gab an, kein Vertrauen in Herrn C zu haben. Er habe Termine abgesagt, sich nicht um die Gebäudeversicherung gekümmert und sich geweigert, selbst Alternativangebote für die Abstimmung einzuholen.
Sie bestritt außerdem, die unzulässige GbR erneut vorschlagen zu wollen. Stattdessen habe sie eine andere Firma namens „L Immobilien“ oder den Gesellschafter Herrn L persönlich als Alternative ins Spiel gebracht.
Wie hat das Gericht entschieden?
Das Gericht fällte eine differenzierte Entscheidung. Es gab den Klägern teilweise recht, aber nicht im vollen Umfang.
- Herr C wurde zum Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft bestellt.
- Allerdings wurde er nicht, wie von den Klägern für vier Jahre beantragt, sondern nur für die Dauer von einem Jahr bestellt.
- Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen.
Was bedeutet das konkret? Die Kläger haben ihr Hauptziel erreicht: Die Gemeinschaft hat nun einen handlungsfähigen und neutralen Verwalter. Die Blockade ist durchbrochen. Die Beklagte wiederum muss die Bestellung von Herrn C akzeptieren, hat aber nach einem Jahr die Chance, in einer neuen Versammlung eine andere Lösung durchzusetzen.
Warum hat das Gericht überhaupt einen Verwalter eingesetzt?
Das Gericht erklärte, dass jeder Wohnungseigentümer einen grundlegenden Anspruch darauf hat, dass die Gemeinschaft einen Verwalter hat. Da die Eigentümer sich offensichtlich nicht einigen konnten und die Gemeinschaft ab August 2018 ohne Verwalter dagestanden hätte, durfte das Gericht eingreifen. Dies liegt im sogenannten Ermessen des Gerichts. Das bedeutet, das Gericht hat einen gewissen Spielraum, um eine faire und vernünftige Lösung zu finden, ähnlich wie ein Schiedsrichter, der eine Situation nach den Regeln, aber auch mit Augenmaß bewertet.
Den Einwand der Beklagten, es hätten drei Vergleichsangebote vorliegen müssen, wies das Gericht zurück. Es bezog sich dabei auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.
- Die Richter erklärten: Zwar ist es bei der allerersten Bestellung eines neuen Verwalters üblich und richtig, mehrere Angebote einzuholen.
- Hier ging es aber um die „Wiederbestellung“ des bereits amtierenden, gerichtlich eingesetzten Verwalters Herrn C. Ein gerichtlich bestellter Verwalter hat rechtlich dieselbe Stellung wie ein von der Gemeinschaft gewählter.
- In einem solchen Fall ist es nicht die Aufgabe des amtierenden Verwalters, sich selbst Konkurrenz zu suchen. Wenn Eigentümer – wie hier die Beklagte – unzufrieden sind oder Alternativen wünschen, ist es ihre Aufgabe, selbst entsprechende Angebote einzuholen und zur Abstimmung zu stellen. Da die Beklagte dies nicht getan hatte, konnte sie den anderen diesen Punkt nicht vorwerfen.
Warum wurde Herr C ausgewählt, aber nur für ein Jahr?
Das Gericht prüfte die Eignung der Kandidaten. Den von der Beklagten vorgeschlagenen Herrn L (bzw. seine Firmen) stufte es als ungeeignet ein. Der Grund: Ihm wurde bereits in einem früheren Verfahren ein „grobes Verschulden“ angelastet, weil er als professioneller Verwalter hätte wissen müssen, dass seine GbR nicht als Verwalterin bestellt werden durfte. Wer solch grundlegende rechtliche Fehler macht, ist für das Gericht nicht vertrauenswürdig.
Herrn C hingegen sah das Gericht als geeignete und neutrale Wahl an. Er war bereits eingearbeitet, kannte die Immobilie und die Mehrheit der Eigentümer (nach Köpfen, nicht nach Anteilen) war mit ihm zufrieden. Die von der Beklagten vorgebrachten Kritikpunkte hielt das Gericht für nicht schwerwiegend genug, um ihn als ungeeignet einzustufen.
Aber warum dann nur für ein Jahr und nicht für die beantragten vier Jahre? Hier liegt der juristische Kern der Entscheidung:
- Die Kläger wollten das Gericht zwingen, den konkreten Beschluss (Bestellung von Herrn C für 4 Jahre) durchzusetzen. Ein Gericht tut dies aber nur, wenn es keine andere vernünftige Alternative gibt.
- Das Gericht argumentierte jedoch, dass es nicht zwingend einer ordnungsgemäßen Verwaltung entspricht, einen Verwalter, den die Gemeinschaft erst wenige Monate kennt, sofort für die lange Dauer von vier Jahren zu binden. Es ist absolut vernünftig und nachvollziehbar, wenn Eigentümer hier zunächst eine kürzere „Probezeit“ wünschen.
- Daher konnte das Gericht dem Antrag auf eine vierjährige Bestellung nicht stattgeben. Stattdessen nutzte es sein Ermessen und setzte eine aus seiner Sicht faire Dauer fest: ein Jahr. Dies gibt der Gemeinschaft einen funktionierenden Verwalter und gleichzeitig die Möglichkeit, sich innerhalb dieses Jahres neu zu orientieren und vielleicht doch noch eine einvernehmliche Lösung für die Zukunft zu finden.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil des Amtsgerichts Bonn verdeutlicht, wie Gerichte bei blockierten Wohnungseigentümergemeinschaften vermittelnd eingreifen können, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten.
- Gerichtliche Ersatzvornahme bei Pattstellungen: Das Urteil bestätigt, dass Gerichte einen Verwalter bestellen können, wenn sich Eigentümer nicht einigen können und dadurch die ordnungsgemäße Verwaltung gefährdet ist. Dabei übt das Gericht Ermessen aus und muss nicht zwingend den ursprünglich beantragten Beschluss vollständig umsetzen.
- Unterschiedliche Anforderungen je nach Bestellungsart: Daraus folgt, dass bei der Wiederbestellung eines bereits amtierenden Verwalters keine Vergleichsangebote erforderlich sind, während bei Neubestellungen mehrere Optionen vorliegen sollten. Die Verantwortung für alternative Vorschläge liegt bei unzufriedenen Eigentümern, nicht beim amtierenden Verwalter.
- Verhältnismäßigkeitsprinzip bei Amtsdauer: Das Urteil zeigt, dass Gerichte auch bei berechtigten Anträgen eine kürzere Amtszeit festsetzen können, wenn dies der vernünftigen Verwaltung besser entspricht. Eine „Probezeit“ für noch wenig bekannte Verwalter gilt als sachgerecht gegenüber längerfristigen Bindungen.
Die Entscheidung schafft einen praktikablen Ausgleich zwischen dem Schutz vor Majorisierung und dem Grundsatz, dass Gerichte nur dann eingreifen, wenn es unbedingt erforderlich ist.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche konkreten Schritte kann ich als Wohnungseigentümer einleiten, wenn unsere WEG keinen Verwalter findet oder sich nicht einigen kann?
Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) keinen Verwalter findet oder sich die Eigentümer nicht auf einen einigen können, kann dies die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft stark beeinträchtigen. Die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums ist eine Kernaufgabe und jede WEG muss einen Verwalter haben (§ 26 Abs. 1 Satz 1 Wohnungseigentumsgesetz – WEG). Fehlt dieser, gibt es verschiedene Wege, um aus der Pattsituation herauszukommen.
Interne Lösungsversuche durch den Eigentümer
Ein einzelner Wohnungseigentümer kann zunächst versuchen, die Situation innerhalb der Gemeinschaft zu lösen:
- Einberufung einer Eigentümerversammlung initiieren: Wenn keine Versammlung einberufen wird, obwohl ein dringender Bedarf besteht (z.B. für die Verwalterbestellung), kann ein einzelner Eigentümer unter bestimmten Voraussetzungen die Einberufung einer Eigentümerversammlung verlangen. Dafür ist oft erforderlich, dass mehr als ein Viertel der Wohnungseigentümer dies schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Beiratsvorsitzenden oder einem dazu ermächtigten Eigentümer fordern (§ 24 Abs. 3 WEG). Auf dieser Versammlung kann dann erneut versucht werden, einen Verwalter zu bestellen.
- Vorschläge und Kandidaten einbringen: Der Eigentümer kann aktiv werden, indem er geeignete Verwalterkandidaten vorschlägt, Angebote einholt und diese der Gemeinschaft präsentiert. Eine Wahl des Verwalters erfolgt in der Regel durch einen Beschluss der Eigentümerversammlung, wofür oft eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreicht (§ 25 Abs. 1 WEG).
Gerichtliche Bestellung eines Verwalters
Wenn alle internen Versuche scheitern und die WEG weiterhin „verwalterlos“ ist, das heißt, sie hat keinen bestellten Verwalter, kann ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden. Dies ist der Weg, um einen sogenannten gerichtlichen „Notverwalter“ zu bekommen:
- Antragsrecht jedes einzelnen Eigentümers: Jeder einzelne Wohnungseigentümer hat das Recht, beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen, dass ein Verwalter bestellt wird. Dieses Recht ist im § 26 Abs. 1 Satz 2 WEG in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Satz 2 WEG festgelegt. Die gerichtliche Bestellung dient dazu, die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft sicherzustellen, wenn die Eigentümer dies nicht selbst können oder wollen.
- Verfahren beim Gericht: Der Antrag wird beim Amtsgericht gestellt, in dessen Bezirk die Immobilie liegt. Das Gericht prüft die Voraussetzungen und bestellt, falls diese vorliegen, einen Verwalter. Das Gericht wählt dabei eine geeignete Person oder ein Unternehmen aus.
- Aufgaben und Dauer des gerichtlich bestellten Verwalters: Der vom Gericht eingesetzte Verwalter hat die gleichen Aufgaben und Befugnisse wie ein von der Gemeinschaft bestellter Verwalter. Häufig wird dieser Notverwalter für einen begrenzten Zeitraum bestellt, beispielsweise für ein Jahr. Dies gibt der Eigentümergemeinschaft Zeit, sich in dieser Frist selbst auf einen neuen Verwalter zu einigen und diesen in einer regulären Eigentümerversammlung zu bestellen.
Praktische Auswirkungen: Für die Eigentümergemeinschaft bedeutet das Fehlen eines Verwalters, dass wichtige Entscheidungen nicht getroffen und notwendige Maßnahmen (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Abrechnungen) nicht umgesetzt werden können. Die Möglichkeit, einen Verwalter gerichtlich bestellen zu lassen, stellt einen wichtigen Hilfsmechanismus dar, um die Handlungsfähigkeit der WEG wiederherzustellen und größere Schäden oder rechtliche Probleme zu vermeiden. Sie unterstreicht, dass das Wohnungseigentumsgesetz die ordnungsgemäße Verwaltung des Gemeinschaftseigentums als essenziell ansieht.
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Gericht einen Not-Verwalter für eine Wohnungseigentümergemeinschaft bestellen?
Ein Gericht kann einen sogenannten Not-Verwalter für eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) bestellen, wenn die Gemeinschaft dringend eine Verwaltung benötigt, diese aber aus eigener Kraft nicht einsetzen kann. Das ist eine wichtige Möglichkeit, um die Handlungsfähigkeit einer WEG sicherzustellen, falls die reguläre Verwaltung nicht funktioniert.
Wann ein Not-Verwalter bestellt wird
Die Bestellung eines Not-Verwalters ist in Deutschland im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt, insbesondere in § 45 WEG. Ein Gericht wird in der Regel nur unter sehr bestimmten, engen Voraussetzungen tätig:
- Es gibt keinen amtierenden Verwalter: Dies ist die grundlegende Voraussetzung. Das bedeutet, es ist entweder überhaupt kein Verwalter bestellt worden, die Amtszeit des letzten Verwalters ist abgelaufen, der Verwalter hat gekündigt, oder er ist aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen (z.B. bei Krankheit oder dauerhafter Unerreichbarkeit). Stellen Sie sich vor, der Verwalter ist plötzlich nicht mehr erreichbar, die Heizung fällt im Winter aus und niemand kümmert sich.
- Dringende Notwendigkeit für die Gemeinschaft: Es muss einen dringenden Handlungsbedarf geben. Das bedeutet, dass wichtige Angelegenheiten der Wohnungseigentümergemeinschaft nicht erledigt werden können und dadurch erhebliche Nachteile oder sogar Schäden für die Gemeinschaft entstehen könnten. Beispiele hierfür sind:
- Unbezahlte Rechnungen: Keine Müllabfuhr, kein Strom oder Wasser mehr, weil niemand die Betriebskostenabrechnungen erstellt und Gelder verwaltet.
- Keine Instandhaltung: Dringende Reparaturen am Gebäude (z.B. am Dach, an Leitungen) werden nicht veranlasst, weil niemand zuständig ist.
- Fehlende Beschlussfähigkeit: Es können keine gültigen Eigentümerversammlungen abgehalten werden, um notwendige Entscheidungen zu treffen.
- Die Eigentümer können keinen Verwalter bestellen: Das Gericht wird nur dann tätig, wenn die Wohnungseigentümer selbst nicht in der Lage sind, einen neuen Verwalter zu bestellen. Das ist oft der Fall, wenn:
- Es aufgrund von Streitigkeiten oder Blockaden unter den Eigentümern keine Mehrheit für die Wahl eines neuen Verwalters gibt.
- Immer wieder keine beschlussfähige Versammlung zustande kommt, weil nicht genügend Eigentümer anwesend sind.
- Die Situation so verfahren ist, dass die Eigentümer aus eigener Kraft die Verwaltungskrise nicht lösen können.
Zweck und zeitliche Begrenzung der Bestellung
Der Not-Verwalter wird vom Gericht bestellt, um eine Lücke zu schließen und die Handlungsfähigkeit der WEG wiederherzustellen, bis die Eigentümer selbst einen regulären Verwalter wählen können. Die Bestellung ist daher meist zeitlich befristet, oft auf ein Jahr. In dieser Zeit soll der Not-Verwalter die dringendsten Aufgaben erledigen und bestenfalls die Grundlage dafür schaffen, dass die Eigentümergemeinschaft wieder einen ordentlichen Verwalter wählen kann. Er hat in der Regel die Befugnisse eines normalen Verwalters, fokussiert sich aber auf das Wesentliche.
Was bedeutet ordnungsgemäße Verwaltung für eine WEG und warum ist sie für die Verwalterbestellung entscheidend?
Die „ordnungsgemäße Verwaltung“ ist ein grundlegendes Prinzip im Wohnungseigentumsrecht und der zentrale Maßstab dafür, wie das Gemeinschaftseigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) geführt werden muss. Stellen Sie sich Ihre WEG wie ein kleines Unternehmen oder einen großen Haushalt vor, der gut organisiert sein muss, damit alles funktioniert und die Werte erhalten bleiben.
Was „ordnungsgemäße Verwaltung“ bedeutet
Für Sie als Wohnungseigentümer bedeutet „ordnungsgemäße Verwaltung“, dass das gemeinsame Eigentum – also zum Beispiel das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, der Garten oder die Heizungsanlage – so betreut und instandgehalten wird, dass es seinen Wert behält, funktionsfähig bleibt und das friedliche Zusammenleben aller Eigentümer gewährleistet ist. Dazu gehören viele Aufgaben, wie:
- Regelmäßige Instandhaltung und Instandsetzung: Das Gebäude wird gepflegt und notwendige Reparaturen werden durchgeführt, um Schäden und Wertverlust zu vermeiden (z.B. Dachreparaturen, Heizungswartung).
- Korrekte Buchführung und Abrechnungen: Die Einnahmen und Ausgaben der WEG werden transparent und nachvollziehbar erfasst, der Wirtschaftsplan erstellt und die Jahresabrechnungen korrekt aufgestellt.
- Durchführung von Beschlüssen: Die von den Wohnungseigentümern in der Versammlung gefassten Beschlüsse werden umgesetzt (z.B. Renovierungsarbeiten, neue Hausordnung).
- Einhaltung von Gesetzen und Regeln: Die Verwaltung richtet sich nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und anderen relevanten Vorschriften.
- Angemessene Versicherungen: Das Gemeinschaftseigentum ist ausreichend versichert.
Kurz gesagt, es geht darum, das Gemeinschaftseigentum vorausschauend, wirtschaftlich und im Interesse aller Eigentümer zu verwalten.
Die entscheidende Rolle des Verwalters
Der Verwalter ist die zentrale Figur, die diese vielfältigen Aufgaben der „ordnungsgemäßen Verwaltung“ im Alltag übernimmt. Er ist der Motor der WEG, der dafür sorgt, dass Beschlüsse umgesetzt werden, Handwerker beauftftragt werden, das Geld verwaltet wird und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.
Wenn eine WEG keinen Verwalter hat oder der amtierende Verwalter seine Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß erfüllt (zum Beispiel, weil er gekündigt hat, die Amtszeit abgelaufen ist und kein neuer gefunden wird, oder er schlichtweg unfähig ist), dann ist die „ordnungsgemäße Verwaltung“ der WEG unmittelbar gefährdet. Ohne einen Verwalter können plötzlich keine Rechnungen mehr bezahlt, keine dringenden Reparaturen beauftragt oder keine notwendigen Entscheidungen in einer Eigentümerversammlung herbeigeführt werden. Das Gebäude kann verfallen, und es kann zu finanziellen oder rechtlichen Problemen kommen.
Warum die Verwalterbestellung für die ordnungsgemäße Verwaltung entscheidend ist
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sieht die Bestellung eines Verwalters ausdrücklich als eine Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung vor. Es ist also eine gesetzlich anerkannte Notwendigkeit. Wenn die Bestellung eines Verwalters blockiert ist, beispielsweise weil sich die Eigentümer nicht auf einen Kandidaten einigen können, ist die Funktionsfähigkeit der gesamten WEG bedroht.
In solchen Fällen, in denen die „ordnungsgemäße Verwaltung“ durch das Fehlen oder die mangelnde Leistungsfähigkeit eines Verwalters ernsthaft beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, bietet das Gesetz einen Schutzmechanismus: Jeder einzelne Wohnungseigentümer kann dann das Gericht anrufen. Das Gericht kann daraufhin einen sogenannten Not-Verwalter bestellen. Dies geschieht, um die Handlungsfähigkeit der WEG wiederherzustellen und sicherzustellen, dass die notwendigsten Verwaltungsaufgaben wieder erledigt werden können. Der Not-Verwalter wird oft für einen begrenzten Zeitraum bestellt, um der Gemeinschaft Zeit zu geben, in Ruhe einen neuen, regulären Verwalter zu finden und zu bestellen. Dies sichert den langfristigen Erhalt Ihres Wohnungseigentums und die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft.
Was kann ich tun, wenn ein Mehrheitseigentümer die Bestellung eines Verwalters systematisch blockiert?
Wenn in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ein Mehrheitseigentümer oder mehrere Mehrheitseigentümer die wichtige Bestellung eines Verwalters bewusst und systematisch verhindern, ist die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft stark eingeschränkt. Ohne einen Verwalter können viele alltägliche Dinge, wie die Abrechnung von Heizkosten, die Beauftragung von Reparaturen am Gemeinschaftseigentum oder die Verwaltung der Finanzen, nicht ordnungsgemäß erledigt werden. Das Gesetz bietet hierfür Wege, um solche Blockaden zu überwinden und die Funktionsfähigkeit der WEG wiederherzustellen.
Gerichtliche Bestellung eines Verwalters
Der wichtigste rechtliche Weg, um eine systematische Blockade bei der Verwalterbestellung zu durchbrechen, ist die gerichtliche Bestellung eines Verwalters. Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sieht vor, dass jeder einzelne Wohnungseigentümer das Gericht anrufen kann, wenn kein Verwalter bestellt ist und dies für eine ordnungsgemäße Verwaltung der Gemeinschaft notwendig ist. Dies ist besonders relevant, wenn eine Mehrheit die Bestellung eines Verwalters immer wieder scheitern lässt.
Was bedeutet das in der Praxis? Wenn die Eigentümer in ihren Versammlungen trotz mehrmaliger Versuche keinen Verwalter bestimmen können, weil eine Mehrheit dies konsequent verhindert, kann ein einzelner Miteigentümer beantragen, dass ein Gericht einen Verwalter bestimmt. Das Gericht prüft dann, ob die Bestellung eines Verwalters für die Gemeinschaft unabdingbar ist. Da eine WEG ohne Verwalter kaum funktionieren kann, wird dies in der Regel bejaht. Das Gericht wählt dann eine geeignete Person aus und bestellt diese als Verwalter für einen bestimmten Zeitraum, oft für ein Jahr. Für Sie bedeutet das, dass die WEG auch gegen den Widerstand einzelner Eigentümer wieder einen handlungsfähigen Kopf bekommt, der die laufenden Geschäfte führen kann.
Anfechtung von Beschlüssen
Eine weitere Möglichkeit, die in bestimmten Fällen relevant sein kann, ist die Anfechtung von Beschlüssen der Eigentümerversammlung. Stellen Sie sich vor, in einer Versammlung wird ein Beschluss gefasst, der die Bestellung eines Verwalters bewusst behindert oder eine völlig ungeeignete Person als Verwalter bestimmt, obwohl es bessere Optionen gäbe und dies der ordnungsgemäßen Verwaltung widerspricht. Solche Beschlüsse können von jedem Wohnungseigentümer, der von dem Beschluss betroffen ist, gerichtlich angefochten werden. Das Ziel ist es hierbei, den ungültigen Beschluss aufzuheben, um den Weg für eine korrekte Verwalterbestellung freizumachen. Dieser Weg ist jedoch komplexer und setzt voraus, dass tatsächlich ein rechtswidriger Beschluss gefasst wurde, der angegriffen werden kann. Die gerichtliche Bestellung eines Verwalters ist oft der direktere Weg, wenn es um die pure Abwesenheit eines Verwalters geht.
Zweck der rechtlichen Schritte
Die genannten rechtlichen Möglichkeiten dienen alle einem Ziel: die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft. Eine WEG ist auf einen funktionierenden Verwalter angewiesen, um grundlegende Aufgaben wie die Instandhaltung des Gebäudes, die Führung der Finanzen und die Kommunikation mit den Eigentümern zu gewährleisten. Wenn eine systematische Blockade dies verhindert, ermöglicht das Gesetz den Eigentümern, die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft durch gerichtliche Hilfe wiederherzustellen und so größere Schäden oder finanzielle Nachteile für die WEG abzuwenden.
Welche Faktoren beeinflussen die Dauer der gerichtlichen Bestellung eines WEG-Verwalters?
Gerichte nutzen bei der Bestellung eines WEG-Verwalters ihr Ermessen hinsichtlich der Dauer der Bestellung. Dies ist in § 44 Abs. 3 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) geregelt, der dem Gericht die Befugnis gibt, einen Verwalter zu bestellen, wenn die Wohnungseigentümer keinen Verwalter bestellen können oder wollen. Die Dauer ist dabei ein wichtiger Aspekt, der auf die Besonderheiten der jeweiligen Situation der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zugeschnitten wird.
Gerichtliches Ermessen und die „Probezeit“
Wenn ein Gericht einen WEG-Verwalter bestellt, insbesondere als sogenannter Not-Verwalter bei Blockaden, handelt es es sich oft um eine Übergangslösung. Das Gericht möchte damit die Handlungsfähigkeit der WEG wiederherstellen. Häufig wird daher zunächst eine kürzere Bestelldauer gewählt, beispielsweise ein Jahr. Dies dient quasi als „Probezeit“, um zu sehen, ob der eingesetzte Verwalter die festgefahrene Situation auflösen kann und eine Vertrauensbasis in der Gemeinschaft entsteht. Für Sie bedeutet das: Das Gericht möchte der WEG eine Chance geben, nach dieser Zeit wieder selbstständig eine Lösung zu finden und einen Verwalter regulär zu wählen.
Entscheidende Faktoren für die Bestelldauer
Mehrere Überlegungen spielen eine Rolle, wenn das Gericht die Dauer festlegt:
- Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit: Das primäre Ziel ist es, dass die WEG wieder in der Lage ist, wichtige Entscheidungen zu treffen und dringend notwendige Aufgaben zu erledigen. Die Dauer wird so bemessen, dass dies gewährleistet ist.
- Möglichkeit einer einvernehmlichen Lösung: Das Gericht strebt an, dass die Eigentümer in Zukunft wieder selbst in der Lage sind, sich auf einen Verwalter zu einigen. Eine befristete Bestellung soll der Gemeinschaft Zeit geben, neue Vertrauensgrundlagen zu schaffen und eine dauerhafte Lösung ohne gerichtliche Hilfe zu finden.
- Komplexität der Aufgaben: Sind in der WEG viele komplexe oder dringende Probleme ungelöst (z.B. hohe Schulden, notwendige Sanierungen, fehlende Beschlüsse), kann das Gericht eine etwas längere Bestelldauer für notwendig erachten. Dies gibt dem gerichtlich bestellten Verwalter ausreichend Zeit, diese Angelegenheiten zu bearbeiten und die WEG auf eine stabile Basis zu stellen.
- Verhalten der Eigentümer: Die bisherige Kooperationsbereitschaft oder -unfähigkeit der Eigentümer kann ebenfalls ein Faktor sein. Wenn eine tiefe Zerstrittenheit besteht, die eine schnelle Einigung unwahrscheinlich macht, kann dies das Gericht dazu bewegen, eine bestimmte Dauer zu wählen, die Raum für eine Befriedung der Situation lässt.
Einflussmöglichkeiten der Eigentümer
Die Dauer der gerichtlichen Verwalterbestellung liegt im Ermessen des Gerichts. Das bedeutet, das Gericht entscheidet nach eigenem Dafürhalten, was im besten Interesse der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft ist.
Sie als Eigentümer oder die beteiligten Parteien können dem Gericht im Verfahren Vorschläge zur Bestelldauer unterbreiten. Wenn sich alle oder die meisten Eigentümer auf eine bestimmte Dauer einigen können, kann dies die gerichtliche Entscheidung beeinflussen. Das Gericht ist an solche Vorschläge jedoch nicht gebunden, sondern berücksichtigt diese als Teil seiner umfassenden Prüfung. Die endgültige Entscheidung trifft immer das Gericht, um die bestmögliche Lösung für die WEG als Ganzes zu gewährleisten.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Ermessen des Gerichts
Das gerichtliche Ermessen bezeichnet den Spielraum, den ein Gericht oder Richter bei bestimmten Entscheidungen hat. Es bedeutet, dass das Gericht nicht starr an eine einzige Vorgabe gebunden ist, sondern aus mehreren rechtlich zulässigen Optionen diejenige auswählen kann, die es im konkreten Fall für die gerechteste und vernünftigste Lösung hält. Dabei werden alle relevanten Umstände des Falles berücksichtigt. Das Gericht nutzt sein Ermessen, um eine faire und praktische Lösung für die beteiligten Parteien zu finden.
Beispiel: Im Artikel entscheidet das Gericht im Rahmen seines Ermessens, ob und für welche Dauer ein Verwalter eingesetzt wird, wenn die Eigentümer sich nicht einigen können.
Miteigentumsanteile (MEA)
Miteigentumsanteile (MEA) legen fest, wie viel jeder einzelne Eigentümer am Gemeinschaftseigentum einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) besitzt. Sie werden in Bruchteilen (z.B. 100/10.000) ausgedrückt und sind im Grundbuch eingetragen. Die MEA bestimmen oft das Stimmgewicht eines Eigentümers bei Abstimmungen in der Eigentümerversammlung und die Verteilung von Kosten und Lasten. Wer größere Miteigentumsanteile hat, besitzt meist auch mehr Stimmkraft.
Beispiel: Im vorliegenden Fall hatte eine Eigentümerin durch ihre hohen Miteigentumsanteile eine Stimmenmehrheit, die es ihr ermöglichte, Entscheidungen der anderen Eigentümer zu blockieren.
Negativbeschluss
Ein Negativbeschluss ist ein spezieller Begriff aus dem Wohnungseigentumsrecht, der die Ablehnung eines Antrags in einer Eigentümerversammlung bezeichnet. Statt einem Ja zu einem Vorschlag wird bewusst oder implizit ein Nein beschlossen, also der Antrag nicht angenommen. Ein solcher Beschluss kann gerichtlich angefochten werden, wenn er gegen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung verstößt oder die Gemeinschaft unangemessen blockiert.
Beispiel: Im Artikel wurde der Antrag, Herrn C als Verwalter zu bestellen, durch die Mehrheitseigentümerin abgelehnt, was einen anfechtbaren Negativbeschluss darstellte.
Not-Verwalter
Ein Not-Verwalter ist ein Verwalter, der von einem Gericht eingesetzt wird, wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) keinen handlungsfähigen Verwalter hat und sich die Eigentümer nicht selbst auf die Bestellung eines neuen einigen können. Er wird oft für einen begrenzten Zeitraum bestellt. Der Not-Verwalter soll die Handlungsfähigkeit der WEG sicherstellen, indem er die dringendsten Aufgaben übernimmt, bis die Gemeinschaft wieder einen regulären Verwalter wählen kann.
Beispiel: Das Amtsgericht Bonn setzte Herrn C als Not-Verwalter ein, weil die Wohnungseigentümergemeinschaft aufgrund von Streitigkeiten keinen eigenen Verwalter wählen konnte.
Ordnungsgemäße Verwaltung
Die ordnungsgemäße Verwaltung ist ein zentrales Prinzip im Wohnungseigentumsrecht und beschreibt den Idealzustand, wie das Gemeinschaftseigentum einer WEG geführt werden muss. Es bedeutet, dass das gemeinsame Eigentum vorausschauend, wirtschaftlich und im Interesse aller Eigentümer betreut und instandgehalten wird. Dazu gehören die regelmäßige Instandhaltung, korrekte Buchführung, Durchführung von Beschlüssen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Bestellung eines Verwalters ist eine der wichtigsten Maßnahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung.
Beispiel: Das Fehlen eines Verwalters oder dessen Unfähigkeit, die Finanzen zu führen oder Reparaturen zu veranlassen, gefährdet die ordnungsgemäße Verwaltung der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft.
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
Das Wohnungseigentumsgesetz, kurz WEG, ist das zentrale deutsche Gesetz, das alle Rechte und Pflichten regelt, die mit dem Eigentum an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verbunden sind. Es legt fest, wie eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) funktioniert, wie Entscheidungen getroffen werden und wie das Gemeinschaftseigentum verwaltet wird. Das WEG bildet die rechtliche Grundlage für das Zusammenleben und die Verwaltung in Wohnungseigentümergemeinschaften und sichert die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des gemeinsamen Eigentums. Es enthält Bestimmungen zur Eigentümerversammlung, zum Verwalter und zur Aufteilung von Kosten.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 21 Abs. 8 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) (alte Fassung): Dieser Paragraph (in seiner zum Zeitpunkt des Falles gültigen alten Fassung) ermöglichte es einzelnen Wohnungseigentümern, das Gericht einzuschalten. Wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht in der Lage war, eine für die ordnungsgemäße Verwaltung notwendige Entscheidung zu treffen – wie hier die Bestellung eines Verwalters –, konnte das Gericht diese Maßnahme anordnen. Er diente als eine Art Notbremse, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft bei Blockaden sicherzustellen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Dies war die maßgebliche Rechtsgrundlage, auf die sich die klagenden Eigentümer beriefen, um das Gericht dazu zu bewegen, den Verwalter Herrn C für die Wohnungseigentümergemeinschaft zu bestellen.
- Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung: Dieser zentrale Grundsatz des Wohnungseigentumsrechts verlangt, dass alle Entscheidungen und Maßnahmen innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft so getroffen werden, wie es ein vernünftiger und wirtschaftlich denkender Eigentümer tun würde. Er stellt den Maßstab dar, ob eine Handlung oder Unterlassung den Interessen der Gemeinschaft dient. Die Bestellung eines geeigneten Verwalters gilt dabei stets als zwingender Teil der ordnungsgemäßen Verwaltung.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Dieser Grundsatz war der Kern des Streitigkeiten: Die Kläger sahen die Notwendigkeit eines Verwalters als Teil der ordnungsgemäßen Verwaltung, während die Beklagte die fehlende Einholung mehrerer Angebote als Verstoß dagegen anführte.
- Anspruch auf Bestellung eines Verwalters: Jeder einzelne Wohnungseigentümer hat einen unverzichtbaren Anspruch darauf, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft einen geeigneten und funktionsfähigen Verwalter hat. Ein Verwalter ist unerlässlich für die laufende Organisation, die Verwaltung der Finanzen und die Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums. Dieser Anspruch ergibt sich aus dem Recht auf ordnungsgemäße Verwaltung und kann im Falle einer Blockade gerichtlich durchgesetzt werden.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Gemeinschaft sich nicht auf einen Verwalter einigen konnte und die Beklagte die Bestellung blockierte, konnten die Kläger diesen Anspruch gerichtlich geltend machen, um die Bestellung von Herrn C zu erwirken.
- Ermessen des Gerichts bei der Maßnahmenanordnung: Wenn das Gericht auf Antrag eines Wohnungseigentümers eine Maßnahme für die Gemeinschaft trifft, wie die Bestellung eines Verwalters, verfügt es über ein sogenanntes Ermessen. Dies bedeutet, dass das Gericht einen gewissen Entscheidungsspielraum hat, um die konkrete Ausgestaltung der Maßnahme zu bestimmen. Es muss eine Lösung finden, die den Gegebenheiten des Einzelfalls gerecht wird und die Interessen aller Beteiligten angemessen berücksichtigt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht nutzte sein Ermessen, um Herrn C als Verwalter zu bestellen, dies aber nur für ein Jahr statt der beantragten vier Jahre, da dies als angemessener und vernünftiger im Sinne der ordnungsgemäßen Verwaltung angesehen wurde.
- Grundsatz der ordnungsgemäßen Beschlussfassung und Anfechtung von Beschlüssen: Entscheidungen in einer Wohnungseigentümergemeinschaft werden durch Beschlüsse gefasst, die in einer Eigentümerversammlung ordnungsgemäß zustande kommen müssen. Erfüllt ein Beschluss – oder auch ein sogenannter Negativbeschluss, also die Ablehnung eines Antrags – nicht die gesetzlichen oder die Anforderungen der ordnungsgemäßen Verwaltung, kann er gerichtlich angefochten werden. Dies dient dem Schutz der Minderheit vor Willkür oder Fehlern der Mehrheit.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Kläger fochten den Negativbeschluss an, mit dem die Bestellung von Herrn C abgelehnt wurde, da sie diese Ablehnung als bewusste Blockade und damit als Verstoß gegen die ordnungsgemäße Verwaltung ansahen.
Das vorliegende Urteil
AG Bonn – Az.: 27 C 52/18 – Urteil vom 16.08.2018
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.