Eine Wohnungseigentümergemeinschaft forderte Schadensersatz bei fehlerhafter Heizkostenabrechnung von ihrem Messdienstleister für Ungenauigkeiten über mehrere Jahre. Doch die Frage nach der Berechtigung ihres Anspruchs und eigener Pflichten der Gemeinschaft brachte eine unerwartete Komplikation.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Warum scheiterte die Schadensersatzklage einer ganzen Eigentümergemeinschaft?
- Wer bekommt das Geld, wenn die Abrechnungsfirma einen Fehler macht?
- Wie kann eine einzelne Eigentümerin Ansprüche haben, ohne Vertragspartner zu sein?
- Warum hätte die Eigentümerin trotzdem nicht den vollen Schaden ersetzt bekommen?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Experten Kommentar
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie lange kann ich eine falsche Heizkostenabrechnung rechtlich anfechten?
- Habe ich als Eigentümer Rechte gegen den Verwalter bei Prüfpflichtverletzung?
- Wie gehe ich als Eigentümerin bei einer fehlerhaften Abrechnung vor?
- Was, wenn der Schaden durch die Fehlabrechnung nur gering ist?
- Wie schützt sich die WEG vor zukünftigem Mitverschulden bei Abrechnungsfehlern?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 19 U 2746/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht München
- Datum: 20.01.2025
- Aktenzeichen: 19 U 2746/24
- Verfahren: Hinweisbeschluss (vorläufige Einschätzung)
- Rechtsbereiche: Vertragsrecht, Wohnungseigentumsrecht, Schadensrecht
- Das Problem: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft streitet mit einer Abrechnungsfirma über Fehler bei Heizkostenabrechnungen. Die Gemeinschaft fordert von der Firma Schadenersatz.
- Die Rechtsfrage: Kann die Wohnungseigentümergemeinschaft selbst Schadenersatz von der Firma verlangen, oder muss dies der einzelne, direkt betroffene Wohnungseigentümer tun?
- Die Antwort: Nein. Der Schadenersatzanspruch steht dem einzelnen, direkt geschädigten Wohnungseigentümer zu, nicht der Gemeinschaft selbst. Das Gericht begründet dies mit einem sogenannten „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ und sieht zugleich ein Mitverschulden der Gemeinschaft von 40 Prozent.
- Die Bedeutung: Wohnungseigentümergemeinschaften müssen beachten, dass bei fehlerhaften Abrechnungen der Anspruch auf Schadenersatz meist direkt beim einzelnen Wohnungseigentümer liegt. Zudem kann ein eigenes Mitverschulden der Gemeinschaft den Anspruch mindern, wenn sie ihre Prüfpflichten verletzt hat.
Der Fall vor Gericht
Warum scheiterte die Schadensersatzklage einer ganzen Eigentümergemeinschaft?
Ein Messdienstleister macht einen Fehler. Eine Heizkostenabrechnung ist falsch. Der Schaden ist unstrittig. Die Wohnungseigentümergemeinschaft, die den Vertrag mit der Firma geschlossen hat, zieht vor Gericht und fordert Schadensersatz. Sie verliert.
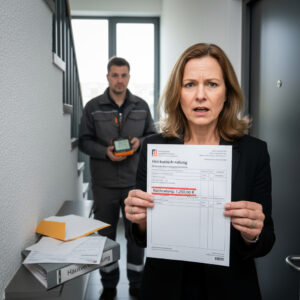
Der Grund ist eine juristische Finesse, die auf den ersten Blick paradox wirkt: Die Gemeinschaft hatte zwar den Vertrag, aber nicht den Schaden. Das Oberlandesgericht München legte in seinem Hinweisbeschluss (Az. 19 U 2746/24) den Finger in die Wunde – und zeigte auf, wer tatsächlich anspruchsberechtigt ist.
Wer bekommt das Geld, wenn die Abrechnungsfirma einen Fehler macht?
Der Fall drehte sich um die entscheidende Frage: Wem steht der Schadensersatzanspruch zu? Der klagenden Gemeinschaft, die den Abrechnungsservice beauftragt hatte? Oder der einzelnen Wohnungseigentümerin, deren Abrechnung konkret falsch war? Die Gemeinschaft argumentierte naheliegend: Sie sei Vertragspartnerin und müsse die Fehler der von ihr beauftragten Firma ausgleichen können.
Das Gericht durchkreuzte diese Logik. Es stellte fest, dass nicht die Gemeinschaft als Verband den finanziellen Nachteil erlitten hatte. Geschädigt war allein die eine Eigentümerin, die zu viel bezahlen musste. Die Gemeinschaft selbst war nur eine Art „Durchlaufposten“. Ihr Vermögen war durch den Ablesefehler nicht geschmälert. Sie war somit nicht „aktivlegitimiert“ – sie war die falsche Klägerin. Die Befugnis, Rechte für einzelne Eigentümer auszuüben, gibt das Wohnungseigentumsgesetz in einem solchen Fall nicht her (§ 9a Abs. 2 WEG).
Die Richter griffen stattdessen auf eine juristische Figur zurück, die für solche Konstellationen geschaffen wurde: den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Im Klartext bedeutet das: Der Vertrag zwischen der Gemeinschaft und der Abrechnungsfirma entfaltet eine Schutzwirkung, die über die direkten Vertragspartner hinausreicht und die einzelnen Eigentümer mit einbezieht.
Wie kann eine einzelne Eigentümerin Ansprüche haben, ohne Vertragspartner zu sein?
Ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter entsteht nicht automatisch. Das Gericht prüfte vier klare Voraussetzungen, die hier allesamt erfüllt waren.
- Leistungsnähe: Die einzelne Eigentümerin kam mit der Leistung der Abrechnungsfirma direkt in Berührung. Die für sie erstellte Einzelabrechnung war das Kernprodukt des Vertrags.
- Einbeziehungsinteresse: Die Gemeinschaft hatte ein klares Interesse daran, ihre Mitglieder zu schützen. Die korrekten Einzelabrechnungen sind entscheidend für den Hausfrieden und die Gültigkeit der Jahresabrechnung (§ 28 Abs. 2 WEG).
- Erkennbarkeit: Für die Abrechnungsfirma war von Anfang an klar, dass ihre Arbeit nicht für die Gemeinschaft als abstrakte Einheit, sondern für die einzelnen Bewohner bestimmt ist. Dies war für sie offensichtlich und zumutbar.
- Schutzbedürftigkeit: Die einzelne Eigentümerin war schutzbedürftig. Sie selbst hatte keinen direkten Vertrag mit der Abrechnungsfirma. Ohne die Schutzwirkung des Hauptvertrages stünde sie ohne einen wirksamen vertraglichen Anspruch da.
Weil diese vier Punkte zutrafen, entstand ein eigener, direkter Schadensersatzanspruch der geschädigten Eigentümerin gegen die Abrechnungsfirma. Sie hätte klagen müssen – nicht die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist lediglich verpflichtet, ihr alle nötigen Informationen für die Klage zur Verfügung zu stellen.
Warum hätte die Eigentümerin trotzdem nicht den vollen Schaden ersetzt bekommen?
Selbst wenn die richtige Person geklagt hätte, wäre der Anspruch wohl nicht in voller Höhe durchgegangen. Hier kam ein zweiter, entscheidender Punkt ins Spiel: das Mitverschulden. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abrechnungsfirma fand sich eine Klausel. Diese verpflichtete die Gemeinschaft, die gelieferten Abrechnungen vor der Weiterleitung an die Bewohner auf Plausibilität und erkennbare Fehler zu prüfen.
Dieser Prüfpflicht war die Gemeinschaft offenbar nicht nachgekommen. Das Gericht signalisierte, dass es die Einschätzung der Vorinstanz für nachvollziehbar hielt, diesen Umstand als Mitverschulden nach § 254 BGB zu werten. Eine Kürzung des Schadensersatzanspruchs um 40 Prozent erschien den Richtern nicht abwegig. Dieses Mitverschulden der Gemeinschaft müsste sich die einzelne Eigentümerin anrechnen lassen. Der Grund liegt in einer simplen Rechtslogik: Der Schutz aus dem Vertrag kann nicht weiter reichen als die Rechte des eigentlichen Vertragspartners. Hätte die Gemeinschaft selbst einen Schaden erlitten, wäre ihr Anspruch ebenfalls um 40 Prozent gekürzt worden. Dasselbe Schicksal ereilt die geschützte Dritte.
Die Urteilslogik
Ein Vertragspartner kann nicht immer Schadensersatz für einen Schaden einfordern, den ein Dritter erleidet, selbst wenn der Fehler aus diesem Vertrag resultiert.
- Anspruchsberechtigung bei Drittschaden: Wer einen Vertrag schließt, erhält nicht zwingend den Anspruch auf Schadensersatz, wenn der tatsächliche finanzielle Schaden bei einem Dritten eintritt.
- Schutzwirkung zugunsten Dritter: Ein Vertrag entfaltet unter bestimmten Umständen eine Schutzwirkung zugunsten Dritter, wodurch Personen ohne direkte Vertragsbeziehung dennoch eigenständige Ansprüche gegen den Verursacher erlangen.
- Auswirkungen von Mitverschulden: Begeht der ursprüngliche Vertragspartner eine Pflichtverletzung, die zu einem Mitverschulden führt, mindert dies auch den Schadensersatzanspruch der geschützten Dritten.
Diese Prinzipien unterstreichen die Komplexität der Anspruchsdurchsetzung im Recht und definieren klar, wer für Schäden haftet und wer sie einfordern kann.
Benötigen Sie Hilfe?
Sind Sie unsicher, wer bei fehlerhaften Heizkostenabrechnungen Schadensersatz fordern kann? Erhalten Sie eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihrer spezifischen Situation.
Experten Kommentar
Ein Fehler bei der Heizkostenabrechnung – und schnell stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich der Geschädigte? Dieses Urteil klärt auf: Die Eigentümergemeinschaft mag zwar der Vertragspartner sein, doch der direkte Anspruch auf Schadensersatz liegt beim einzelnen Eigentümer. Das bringt eine wichtige Konsequenz mit sich: Eine unterlassene Prüfung der Abrechnungen durch die Gemeinschaft wird dem Geschädigten angelastet und kann dessen Erstattung deutlich schmälern. Für alle Beteiligten heißt das: Genaues Hinsehen lohnt sich doppelt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lange kann ich eine falsche Heizkostenabrechnung rechtlich anfechten?
Sie haben grundsätzlich 12 Monate Zeit, um einer fehlerhaften Heizkostenabrechnung nach Erhalt zu widersprechen. Zusätzlich können Ansprüche auf Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist geltend gemacht werden. Der Kontext-Artikel hebt jedoch hervor, dass ein Schadensersatzanspruch gegen den Messdienstleister, etwa bei Ablesefehlern, oft direkt Ihnen als Eigentümer zusteht, nicht der WEG.
Die Fristen zur Anfechtung einer Heizkostenabrechnung sind vielschichtig. Zunächst einmal muss die Abrechnung selbst innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums erstellt und Ihnen zugestellt werden. Anschließend haben Sie als Empfänger weitere 12 Monate Zeit, schriftlich Widerspruch gegen inhaltliche Fehler zu erheben. Wird die Jahresabrechnung der WEG, in die die Heizkosten einfließen, per Beschluss genehmigt, müssen Sie diesen Beschluss binnen eines Monats gerichtlich anfechten, um formelle Fehler zu korrigieren.
Allerdings gibt es auch materielle Fehler, die eine Rückforderung von zu viel gezahltem Geld begründen. Solche Ansprüche unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Frist beginnt in der Regel am Ende des Jahres, in dem Sie von den Fehlern Kenntnis erlangt haben oder hätten erlangen müssen. Eine wichtige Unterscheidung macht unser Artikel: Ein direkter Schadensersatzanspruch gegen den Messdienstleister, beispielsweise bei gravierenden Ablesefehlern, steht Ihnen als einzelnem Eigentümer zu, da ein „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ vorliegt. Die WEG ist hier nicht aktivlegitimiert. Denken Sie daran: Selbst ein berechtigter Anspruch kann durch Mitverschulden der WEG – etwa durch eine mangelnde Prüfpflicht – um bis zu 40 Prozent gekürzt werden.
Ein passender Vergleich ist: Ihre Heizkostenabrechnung ist wie ein Zugticket. Sie können das Ticket innerhalb einer bestimmten Frist umtauschen, wenn es falsch ausgestellt wurde. Haben Sie aber aufgrund eines Fehlers der Bahngesellschaft zu viel bezahlt, ist das eine separate Reklamation für eine Rückzahlung, die länger möglich ist.
Öffnen Sie sofort Ihre letzte Jahresabrechnung der WEG und das Protokoll der zugehörigen Eigentümerversammlung. Prüfen Sie dort die spezifischen Beschlüsse zur Genehmigung der Heizkostenabrechnung und identifizieren Sie mögliche Fristen für Widersprüche oder Anfechtungen. Handeln Sie zügig, um keine Rechte zu verlieren, und ziehen Sie bei komplexen Fehlern rechtlichen Rat hinzu, um Ihren individuellen Schadensersatzanspruch direkt prüfen zu lassen.
Habe ich als Eigentümer Rechte gegen den Verwalter bei Prüfpflichtverletzung?
Ja, als Wohnungseigentümer haben Sie durchaus Rechte, wenn der Verwalter die Prüfpflicht der WEG bei Abrechnungen verletzt. Eine solche Pflichtverletzung des Verwalters kann zu einer Kürzung Ihres Schadensersatzanspruchs führen. Juristen sehen darin ein starkes Indiz für eine Pflichtverletzung seinerseits, für die er gegenüber der Gemeinschaft haftbar gemacht werden kann, insbesondere wenn dadurch Ihr individueller Anspruch geschmälert wird.
Die Regel lautet: Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist vertraglich oft dazu verpflichtet, gelieferte Heizkostenabrechnungen vor der Weiterleitung an die Bewohner sorgfältig auf Plausibilität und erkennbare Fehler zu prüfen. Werden diese AGB-Plichten missachtet, wertet das Gericht dies als Mitverschulden der WEG an einem entstandenen Schaden. Das Problem: Dieses Mitverschulden der Gemeinschaft wirkt sich direkt auf Ihren individuellen Schadensersatzanspruch aus und kann diesen, wie Gerichte andeuten, um bis zu 40 Prozent schmälern.
Der Verwalter ist das ausführende Organ der WEG. Er ist für die ordnungsgemäße Geschäftsführung zuständig. Missachtet die Gemeinschaft diese Prüfpflicht, ist das in den meisten Fällen eine direkte Verfehlung des Verwalters. Die daraus resultierende Kürzung Ihres Schadens stellt einen konkreten Vermögensschaden dar, für den der Verwalter der WEG gegenüber Rechenschaft ablegen und gegebenenfalls haften muss.
Denken Sie an die Situation eines Dirigenten: Er ist für die Gesamtleistung des Orchesters verantwortlich. Wenn ein Musiker einen Fehler macht, der nicht korrigiert wird, weil der Dirigent die Partitur nicht aufmerksam genug geprüft hat, dann ist der Dirigent für die mangelnde Gesamtleistung haftbar. Hier ist der Verwalter der Dirigent der WEG.
Handeln Sie proaktiv: Fordern Sie umgehend das Protokoll der relevanten Eigentümerversammlung sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Messdienstleisters an. So kennen Sie die konkrete Formulierung der Prüfpflicht der WEG. Anschließend fordern Sie den Verwalter schriftlich dazu auf, detailliert darzulegen, wie und wann er dieser Pflicht nachgekommen ist. Dokumentieren Sie jeden Schritt.
Wie gehe ich als Eigentümerin bei einer fehlerhaften Abrechnung vor?
Als Eigentümerin mit einer fehlerhaften Heizkostenabrechnung müssen Sie Ihren Schadensersatzanspruch direkt gegen den Messdienstleister geltend machen. Das ist wichtig, denn die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist dafür nicht klageberechtigt. Ihnen steht durch einen juristischen „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ ein eigener, direkter Anspruch zu. Sammeln Sie alle Belege und bereiten Sie Ihre Klage vor.
Juristen nennen das Prinzip der „aktivlegitimierten“ Partei. Der entscheidende Punkt ist: Nicht die gesamte Wohnungseigentümergemeinschaft hat den Schaden erlitten, wenn Ihre Einzelabrechnung fehlerhaft ist. Vielmehr sind Sie als einzelne Eigentümerin diejenige, deren Geld unrechtmäßig geflossen ist. Daher ist die WEG in diesem Fall die falsche Klägerin, auch wenn sie den Vertrag mit dem Messdienstleister geschlossen hat.
Ihre Berechtigung, Schadensersatz zu fordern, leitet sich aus einem „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ ab. Dieser juristische Kniff ermöglicht es Ihnen, einen direkten Anspruch gegen die Abrechnungsfirma zu haben, obwohl Sie selbst keinen direkten Vertrag mit ihr unterzeichnet haben. Die WEG ist dabei lediglich zur Kooperation verpflichtet und muss Ihnen alle nötigen Unterlagen für Ihre eigene Klage zur Verfügung stellen.
Ein passender Vergleich ist der eines kaputten Mietwagens: Obwohl Ihr Arbeitgeber den Mietvertrag abgeschlossen hat, sind Sie als Fahrer direkt geschädigt, wenn der Wagen während Ihrer Fahrt kaputtgeht und Ihnen Kosten entstehen. Sie können dann unter Umständen direkt vom Vermieter Entschädigung verlangen, ohne dass Ihr Arbeitgeber dazwischenschalten muss.
Handeln Sie proaktiv: Erstellen Sie eine detaillierte Auflistung sämtlicher Fehler in Ihrer Abrechnung. Fordern Sie anschließend schriftlich und nachweisbar, am besten per Einschreiben, vom Verwalter alle relevanten Unterlagen an. Dazu gehören der Vertrag mit dem Messdienstleister, dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die Ableseprotokolle und die vollständige Jahresabrechnung der WEG. Diese Dokumente sind unerlässlich, um Ihre direkte Klage vorzubereiten und zu fundieren.
Was, wenn der Schaden durch die Fehlabrechnung nur gering ist?
Ein geringer Schaden durch eine fehlerhafte Heizkostenabrechnung kann sich schnell als „Pyrrhussieg“ entpuppen. Juristen warnen: Durch ein mögliches Mitverschulden der WEG wird Ihr Schadensersatzanspruch um bis zu 40 Prozent gekürzt. Der verbleibende Betrag ist dann oft zu gering, um die Kosten und den Aufwand eines rechtlichen Vorgehens wirtschaftlich zu rechtfertigen.
Der Grund hierfür liegt in einer oft übersehenen Klausel: Viele Abrechnungsfirmen verankern in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Prüfpflicht für die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die Gemeinschaft muss gelieferte Abrechnungen auf Plausibilität und erkennbare Fehler hin überprüfen, bevor sie diese an die Bewohner weiterleitet. Versäumt die WEG diese Aufgabe, wird ihr dies als Mitverschulden angerechnet.
Diese Kürzung betrifft dann auch Sie als einzelne Eigentümerin, selbst wenn der Fehler klar beim Messdienstleister liegt. Ein Anspruch von beispielsweise 100 Euro schrumpft so schnell auf 60 Euro. Die Klage selbst ist zudem keine Gemeinschaftsaufgabe; jeder Eigentümer muss seinen Anspruch direkt gegen den Dienstleister geltend machen. Dies erhöht den individuellen Aufwand erheblich.
Ein passender Vergleich ist der eines kaputten Wasserhahns. Wenn Ihr Klempner Pfusch abliefert, Sie den Schaden aber erst nach Monaten bemerken, obwohl Sie ihn täglich nutzen, mindert das Ihre Chancen auf volle Kostenübernahme. Ähnlich ist es hier mit der Prüfpflicht der WEG: Nicht zu prüfen, mindert den Anspruch, selbst wenn der Fehler ursprünglich nicht bei Ihnen lag.
Nehmen Sie sich die Zeit, den genauen Mehrbetrag Ihrer fehlerhaften Abrechnung zu ermitteln. Ziehen Sie davon realistisch 40 Prozent ab, um den schlimmsten Fall zu simulieren. Stehen die verbleibende Summe und der zu erwartende Aufwand für einen potenziellen Rechtsstreit (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Zeit) noch in einem vernünftigen Verhältnis? Treffen Sie erst danach eine fundierte Entscheidung über weitere rechtliche Schritte.
Wie schützt sich die WEG vor zukünftigem Mitverschulden bei Abrechnungsfehlern?
Um zukünftiges Mitverschulden bei Abrechnungsfehlern zu vermeiden, muss die WEG ihre vertragliche Prüfpflicht für Heizkostenabrechnungen aktiv wahrnehmen. Diese Pflicht ist oft in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Messdienstleister verankert. Es ist essenziell, dass der Verwalter diese Aufgabe systematisch und nachweisbar erfüllt, um finanzielle Risiken und gekürzte Schadensersatzansprüche abzuwenden.
Die Ursache für ein mögliches Mitverschulden der WEG liegt in der Missachtung einer spezifischen Prüfpflicht. Viele Verträge mit Messdienstleistern enthalten Klauseln, die die Gemeinschaft verpflichten, die gelieferten Abrechnungen vor der Weiterleitung an die Bewohner auf „Plausibilität und erkennbare Fehler“ zu kontrollieren. Eine Verletzung dieser Pflicht kann dazu führen, dass Schadensersatzansprüche einzelner Eigentümer bei fehlerhaften Abrechnungen drastisch gekürzt werden. Juristen nennen das Mitverschulden; das Gericht kann ein solches von bis zu 40 Prozent annehmen.
Zum effektiven Schutz muss die WEG proaktiv sicherstellen, dass ihr Verwalter diese vertragliche Pflicht nicht nur kennt, sondern auch lückenlos umsetzt. Klare interne Prozesse und eine sorgfältige Dokumentation sind dabei unerlässlich. So wird Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prüfung gewährleistet. Bei der Verhandlung zukünftiger Verträge mit Dienstleistern sollte die WEG zudem die Prüfpflichtklauseln genau unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls nachverhandeln. Die Bedingungen müssen realistisch und innerhalb der Kompetenzen des Verwalters erfüllbar sein.
Ein passender Vergleich ist die Autoinspektion. Bringen Sie Ihr Fahrzeug zur Wartung, folgt die Werkstatt einer Checkliste. Übersieht sie dabei einen offensichtlichen Mangel, entsteht später ein Schaden, für den Sie unter Umständen die Verantwortung teilen. Genau das geschieht bei der WEG: Ignoriert sie die vereinbarte „Checkliste“ der Abrechnungsprüfung, teilt die Gemeinschaft das finanzielle Risiko mit.
Handeln Sie proaktiv: Setzen Sie für die nächste Eigentümerversammlung den Punkt „Prüfkonzept für Heizkostenabrechnungen“ auf die Tagesordnung. Fordern Sie den Verwalter schriftlich auf, ein konkretes, schriftliches Konzept vorzulegen. Dieses Konzept muss die detaillierte Einhaltung der vertraglichen Prüfpflichten beschreiben und die Verantwortlichkeiten klar definieren.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Aktivlegitimation
Aktivlegitimation bedeutet, dass eine Partei das Recht hat, einen Anspruch vor Gericht geltend zu machen, weil sie der tatsächliche Inhaber des betreffenden Rechts ist. Juristen nennen das die Befugnis, als Kläger aufzutreten. Das Gesetz stellt sicher, dass nur derjenige klagt, dessen Rechte unmittelbar betroffen sind, um unnötige Klagen zu vermeiden und die Prozesseffizienz zu gewährleisten.
Beispiel: Im vorliegenden Fall war die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht aktivlegitimiert, da nur die einzelne Eigentümerin den finanziellen Schaden durch die falsche Heizkostenabrechnung erlitten hatte.
Mitverschulden
Mitverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte selbst durch eigenes Verhalten zur Entstehung oder Verschlimmerung eines Schadens beigetragen hat. Die Regelung aus § 254 BGB sorgt für eine gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten und des Schadens. Es wird berücksichtigt, dass niemand den vollen Schaden tragen muss, wenn er ihn selbst mitverursacht hat, und der Schadensersatzanspruch entsprechend gekürzt.
Beispiel: Die mangelnde Prüfpflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft bei den gelieferten Heizkostenabrechnungen wurde als Mitverschulden gewertet, wodurch der Schadensersatzanspruch der Eigentümerin um 40 Prozent gekürzt werden sollte.
Prüfpflicht
Eine Prüfpflicht ist eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, bestimmte Leistungen oder Dokumente auf ihre Korrektheit und Plausibilität hin zu kontrollieren. Solche Pflichten dienen der Qualitätssicherung und Risikominimierung, indem Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden sollen. Das Gesetz will durch die Verpflichtung zur Prüfung die Sorgfalt im Rechtsverkehr erhöhen und Schäden vorbeugen.
Beispiel: Die Wohnungseigentümergemeinschaft hatte gegenüber dem Messdienstleister eine vertraglich vereinbarte Prüfpflicht für die Heizkostenabrechnungen, der sie vor der Weiterleitung an die Bewohner offenbar nicht nachgekommen war.
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
Ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist ein juristisches Konstrukt, das Dritten, die nicht direkte Vertragspartner sind, eigene vertragliche Ansprüche oder Schutzrechte aus einem Hauptvertrag gewährt. Juristen wenden dies an, wenn eine Vertragspartei erkennbar nicht nur die Interessen ihres direkten Partners, sondern auch die bestimmter Dritter schützen soll, welche selbst keinen Vertrag haben. Dies schließt Schutzlücken und verhindert, dass Dritte ohne Anspruch dastehen.
Beispiel: Im vorliegenden Fall ermöglichte der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter der einzelnen Eigentümerin, trotz fehlenden Direktvertrags, Schadensersatzansprüche gegen den Messdienstleister geltend zu machen.
Das vorliegende Urteil
OLG München – Az.: 19 U 2746/24 – Beschluss vom 20.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









