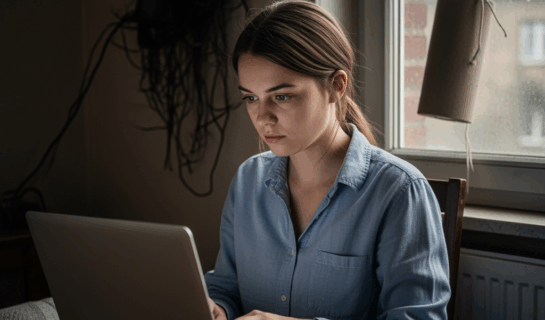Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Nebenkosten zurückfordern: Wann ein unklarer Mietvertrag und die Verjährung entscheidend sind
- Der Weg durch die Instanzen: Zwei Gerichte, zwei unterschiedliche Ergebnisse
- Die erste Kernfrage: War die Zahlungspflicht für kalte Betriebskosten wirksam vereinbart?
- Die zweite Kernfrage: Wann verjähren Ansprüche auf Rückzahlung?
- Die letzte Hürde: Warum die Mieterin für 2013 leer ausging
- Das endgültige Urteil: Eine teilweise Rückzahlung
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie lange kann ich überzahlte Nebenkosten zurückfordern, bevor mein Anspruch verjährt?
- Wann beginnt die Verjährungsfrist für die Rückforderung von Nebenkosten überhaupt zu laufen?
- Was passiert, wenn mein Mietvertrag die Nebenkostenabrechnung unklar regelt oder Passagen gestrichen sind?
- Welche Rechte habe ich, wenn mein Vermieter die Nebenkostenabrechnung nicht oder zu spät schickt?
- Wie lange habe ich Zeit, eine erhaltene Nebenkostenabrechnung zu prüfen und zu beanstanden?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 63 S 206/16 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: LG Berlin
- Datum: 21.03.2017
- Aktenzeichen: 63 S 206/16
- Verfahrensart: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Schuldrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Mieterin, die die Rückzahlung von Nebenkostenvorschüssen verlangte, da die Umlage kalter Betriebskosten im Mietvertrag ihrer Ansicht nach nicht wirksam vereinbart wurde.
- Beklagte: Vermieter, der die Wirksamkeit der Umlage kalter Betriebskosten bejahte und die Einrede der Verjährung geltend machte.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Die Mieterin forderte vom Vermieter die Rückzahlung von Nebenkostenvorschüssen in Höhe von 9.158,19 EUR für die Jahre 2007 bis 2014, da sie die Umlage sogenannter kalter Betriebskosten im Mietvertrag als unwirksam ansah.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob die mietvertragliche Vereinbarung zur Umlage kalter Betriebskosten wirksam war und ob die Rückforderungsansprüche der Mieterin der Verjährung unterlagen. Zudem war zu klären, ob die Mieterin Einwendungen gegen eine Betriebskostenabrechnung fristgerecht erhoben hatte.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Der Vermieter wurde zur Zahlung von 4.704,11 EUR nebst Zinsen an die Mieterin verurteilt. Die Klage wurde im Übrigen abgewiesen.
- Begründung: Die Berufung der Mieterin wurde zurückgewiesen, da sie für das Jahr 2013 keine fristgerechten Einwendungen gegen die Betriebskostenabrechnung erhoben hatte. Die Berufung des Vermieters war teilweise erfolgreich: Es fehlte eine wirksame mietvertragliche Vereinbarung zur Umlage kalter Betriebskosten. Allerdings waren die Rückzahlungsansprüche der Mieterin für die Jahre 2007 bis 2009 verjährt, da die Fälligkeit der Ansprüche bereits mit Ablauf der Abrechnungsfristen eintrat.
- Folgen: Der Vermieter muss Nebenkostenvorschüsse für die Jahre 2010 bis 2014 zurückzahlen, da für diese keine wirksame Umlagevereinbarung für kalte Betriebskosten bestand und die Ansprüche noch nicht verjährt waren. Die Mieterin erhielt keine Rückzahlung für das Jahr 2013, weil sie die Einwendungsfrist versäumt hatte.
Der Fall vor Gericht
Nebenkosten zurückfordern: Wann ein unklarer Mietvertrag und die Verjährung entscheidend sind
Jeder Mieter kennt es: Monat für Monat überweist man neben der Kaltmiete auch eine Vorauszahlung für die Nebenkosten. Doch was passiert, wenn im Mietvertrag gar nicht klar geregelt ist, wofür genau diese Vorauszahlungen eigentlich geleistet werden? Kann man dann jahrelang gezahltes Geld zurückfordern? Und was, wenn der Vermieter sich darauf beruft, dass mögliche Ansprüche längst veraltet sind? Genau mit diesen Fragen musste sich das Landgericht Berlin in einem komplexen Fall auseinandersetzen.

Eine Mieterin hatte über viele Jahre hinweg, von 2007 bis 2014, monatliche Vorauszahlungen für Nebenkosten geleistet. Am Ende forderte sie von ihrem Vermieter eine beeindruckende Summe von 9.158,19 Euro zurück. Ihr Argument war einfach und gleichzeitig weitreichend: Der Mietvertrag, den sie unterschrieben hatte, sei so unklar formuliert, dass sie rechtlich gar nicht verpflichtet gewesen sei, Vorauszahlungen für die sogenannten kalten Betriebskosten zu leisten. Kalte Betriebskosten sind dabei all jene Kosten, die nichts mit Heizung oder Warmwasser zu tun haben, also zum Beispiel die Gebühren für Müllabfuhr, Hausmeister, Gartenpflege oder die Grundsteuer. Ihrer Meinung nach deckten die Zahlungen nur die Heizkosten ab. Der Vermieter sah das naturgemäß anders. Er war der Überzeugung, der Vertrag sei eindeutig und umfasse alle Nebenkosten. Zusätzlich zog er eine juristische Trumpfkarte: die sogenannte Einrede der Verjährung. Damit machte er geltend, dass die Forderungen der Mieterin für die älteren Jahre ohnehin zu alt seien, um sie noch gerichtlich durchsetzen zu können.
Der Weg durch die Instanzen: Zwei Gerichte, zwei unterschiedliche Ergebnisse
Bevor der Fall beim Landgericht landete, hatte bereits das Amtsgericht Schöneberg entschieden. Dieses Gericht gab der Mieterin größtenteils recht. Die Richter dort sahen den Mietvertrag ebenfalls als missverständlich an und verurteilten den Vermieter zur Rückzahlung von über 7.600 Euro. Lediglich für das Jahr 2013 sahen sie keinen Anspruch, da die Mieterin eine entscheidende Frist versäumt hatte. Mit diesem Ergebnis waren aber weder die Mieterin noch der Vermieter zufrieden. Beide legten daher Berufung ein, was bedeutet, dass sie das nächsthöhere Gericht – in diesem Fall das Landgericht Berlin – baten, die Entscheidung zu überprüfen. Damit lag der gesamte Fall erneut auf dem Tisch der Richter.
Die erste Kernfrage: War die Zahlungspflicht für kalte Betriebskosten wirksam vereinbart?
Das Landgericht musste sich zuerst den Mietvertrag selbst ganz genau ansehen. Wie konnte es überhaupt zu einem solchen Streit über die Grundlagen des Vertrags kommen? Die Antwort lag im Detail, genauer gesagt im Aufbau des Formularvertrags.
Was im Kleingedruckten wirklich zählte
Der Vertrag enthielt verschiedene Abschnitte für Nebenkosten. Im Paragrafen zu den Heizkosten waren die Felder für den Umlageschlüssel – also die Regel, nach der die Kosten auf die Mieter verteilt werden – sauber ausgefüllt. Im Paragrafen zu den kalten Betriebskosten hingegen waren genau diese entscheidenden Felder, in denen eine Abrechnungsweise hätte festgelegt werden müssen, ausdrücklich durchgestrichen. Für das Gericht war das ein klares Zeichen. Wer etwas in einem Formular streicht, signalisiert damit deutlich: „Diese Regelung soll hier nicht gelten.“
Der Vermieter argumentierte, dass eine große Klammer an einer anderen Stelle des Vertrags die Vorauszahlung sowohl mit den Heizkosten als auch mit den kalten Betriebskosten verbinde. Doch das Gericht überzeugte das nicht. Es erklärte, dass man einen Vertrag immer als Ganzes betrachten muss. Die deutlich gestrichenen Passagen wogen schwerer als eine mehrdeutige Klammer. Hinzu kam, dass es sich bei dem Vertrag um Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) handelte. Das sind vorformulierte Vertragsklauseln, die eine Seite – hier der Vermieter – der anderen stellt. Man kennt das von Handyverträgen oder beim Online-Shopping. Bei solchen AGB gilt ein wichtiger Grundsatz: Jede Unklarheit geht zulasten desjenigen, der das Formular erstellt hat. Im Zweifel wird die für den Kunden oder Mieter günstigere Auslegung gewählt. Da der Vermieter nicht beweisen konnte, dass die Parteien trotz der Streichungen eine Abrechnung für die kalten Betriebskosten wollten, entschied das Gericht: Es gab keine wirksame Vereinbarung. Die Mieterin musste also tatsächlich keine Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten leisten.
Die zweite Kernfrage: Wann verjähren Ansprüche auf Rückzahlung?
Nachdem klar war, dass die Mieterin grundsätzlich Geld zurückfordern konnte, kam die zweite entscheidende Frage ins Spiel: Für welche Jahre galt dieser Anspruch noch? Hier kam der Begriff der Verjährung ins Spiel. Verjährung ist eine Art juristisches Verfallsdatum. Ein Anspruch, zum Beispiel auf eine Zahlung, existiert zwar rechtlich weiter, kann aber nach Ablauf einer bestimmten Frist – bei Mietansprüchen in der Regel drei Jahre – nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden, wenn sich die andere Seite darauf beruft.
Der entscheidende Moment: Wann beginnt die Frist zu laufen?
Der Knackpunkt war die Frage, wann diese dreijährige Frist zu laufen beginnt. Das Amtsgericht hatte gemeint, die Frist beginne erst, als der Vermieter im Jahr 2012 endlich die Abrechnungen für die Jahre 2007 bis 2011 vorlegte. Das Landgericht sah das jedoch völlig anders und folgte damit einer wichtigen Linie des Bundesgerichtshofs.
Die Richter erklärten: Ein Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, über die Nebenkosten innerhalb eines Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraums abzurechnen. Tut er das nicht, kann der Mieter seine gesamten Vorauszahlungen für das betreffende Jahr zurückverlangen. Dieser Rückforderungsanspruch entsteht also nicht erst, wenn der Vermieter irgendwann eine verspätete Abrechnung schickt, sondern bereits in dem Moment, in dem die Abrechnungsfrist ungenutzt verstreicht. Aber warum ist dieser Unterschied so wichtig? Würde man der Logik des Amtsgerichts folgen, hätte es der Vermieter in der Hand, den Beginn der Verjährung beliebig nach hinten zu verschieben, indem er die Abrechnung einfach immer weiter hinauszögert. Das würde den Mieter benachteiligen und den Sinn der gesetzlichen Abrechnungsfrist untergraben.
Die Rechnung des Gerichts: Welche Jahre waren betroffen?
Mit dieser klaren Regelung rechnete das Gericht nun nach. Schauen wir uns das Beispiel für das Jahr 2009 an:
- Der Abrechnungszeitraum endete am 31. Dezember 2009.
- Die Frist für den Vermieter zur Abrechnung lief bis zum 31. Dezember 2010.
- Da keine Abrechnung kam, wurde der Rückzahlungsanspruch der Mieterin am 1. Januar 2011 fällig.
- Die dreijährige Verjährungsfrist begann damit am 1. Januar 2012 und endete am 31. Dezember 2014.
Die Mieterin hatte ihre Klage aber erst am 31. Dezember 2015 eingereicht – also genau ein Jahr zu spät. Ihr Anspruch für 2009 war damit verjährt. Dasselbe galt für die noch älteren Jahre 2007 und 2008.
Anders sah es jedoch für das Jahr 2010 aus. Hier endete die Verjährungsfrist am 31. Dezember 2015. Da die Klage genau an diesem Tag bei Gericht einging, wurde die Verjährung rechtzeitig gehemmt. Das bedeutet, der Fristablauf wurde gestoppt, so als würde man bei einem Countdown die Pausentaste drücken. Damit waren die Ansprüche für die Jahre 2010, 2011 und 2012 gerettet.
Die letzte Hürde: Warum die Mieterin für 2013 leer ausging
Blieb noch das Jahr 2013. Hier war die Situation anders. Der Vermieter hatte für dieses Jahr eine Abrechnung erstellt und der Mieterin zugeschickt. Laut Gesetz hat ein Mieter nach Erhalt einer Nebenkostenabrechnung eine Frist von zwölf Monaten, um inhaltliche Fehler zu beanstanden. Diese Frist hatte die Mieterin für die Abrechnung des Jahres 2013 verstreichen lassen.
Sie argumentierte, diese Frist könne doch nicht gelten, wenn es nicht nur um einen kleinen Rechenfehler, sondern um die grundsätzliche Frage gehe, ob überhaupt Kosten umgelegt werden dürfen. Das Gericht wies diesen Einwand jedoch zurück. Es stellte klar, dass auch das Fehlen einer vertraglichen Grundlage ein inhaltlicher Fehler der Abrechnung ist. Der Zweck dieser Frist sei es, schnell für Rechtsfrieden zu sorgen. Beide Seiten sollen nach einem Jahr Gewissheit haben, ob eine Abrechnung endgültig ist. Wer diese Frist versäumt, kann später keine Einwände mehr erheben – auch keine so grundsätzlichen.
Das endgültige Urteil: Eine teilweise Rückzahlung
Am Ende stand ein differenziertes Urteil. Das Landgericht änderte die Entscheidung des Amtsgerichts ab. Der Vermieter wurde verurteilt, an die Mieterin 4.704,11 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Diese Summe entsprach den nicht durch Heizkosten verbrauchten Vorauszahlungen für die Jahre 2010 bis 2012 sowie für das Jahr 2014. Die Ansprüche für 2007 bis 2009 waren verjährt, und der Anspruch für 2013 war wegen der versäumten Einwendungsfrist ausgeschlossen. Die Klage wurde im Übrigen abgewiesen, und die Kosten des gesamten Rechtsstreits wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, da jede Seite teils gewonnen und teils verloren hatte.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil zeigt, dass Mieter ihre Nebenkostenvorauszahlungen zurückfordern können, wenn der Mietvertrag unklar formuliert ist und keine eindeutige Vereinbarung über die Zahlung von kalten Betriebskosten (wie Müllabfuhr oder Hausmeister) enthält. Wer als Mieter eine verspätete oder fehlende Nebenkostenabrechnung erhält, muss jedoch schnell handeln: Nach drei Jahren verjähren die Rückzahlungsansprüche und nach Erhalt einer Abrechnung bleibt nur ein Jahr Zeit für Einwände. Vermieter können sich nicht darauf verlassen, dass unklare Vertragsklauseln automatisch zu ihren Gunsten ausgelegt werden – im Zweifel entscheiden Gerichte zugunsten der Mieter. Das Urteil macht deutlich, wie wichtig präzise Mietverträge sind und dass sowohl Mieter als auch Vermieter die gesetzlichen Fristen ernst nehmen müssen.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lange kann ich überzahlte Nebenkosten zurückfordern, bevor mein Anspruch verjährt?
Für die Rückforderung überzahlter Nebenkosten gilt in der Regel die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren.
Diese Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Anspruch auf Rückzahlung entstanden ist und Sie als Mieter von den Umständen, die Ihren Anspruch begründen (zum Beispiel eine zu hohe Nebenkostenabrechnung), Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen müssen.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Erhalten Sie die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2023 im Juni 2024, so beginnt die dreijährige Verjährungsfrist für eventuelle Rückzahlungsansprüche erst am 31. Dezember 2024. Ihr Anspruch verjährt dann am 31. Dezember 2027.
Ist ein Anspruch verjährt, bedeutet dies, dass er zwar rechtlich noch besteht, aber vom Vermieter nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann, wenn sich die Gegenseite auf die Verjährung beruft. Die gesetzlichen Verjährungsfristen dienen dazu, nach einer bestimmten Zeit Rechtssicherheit und klare Verhältnisse für beide Seiten zu schaffen. Daher ist es entscheidend, mögliche Rückforderungsansprüche aus Nebenkostenabrechnungen innerhalb dieser Drei-Jahres-Frist zu verfolgen.
Wann beginnt die Verjährungsfrist für die Rückforderung von Nebenkosten überhaupt zu laufen?
Die Verjährungsfrist für die Rückforderung von Nebenkosten beträgt in Deutschland in der Regel drei Jahre. Der genaue Beginn dieser Frist ist ein oft komplexer Punkt, der für Mieter eine große Rolle spielt, um eigene Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen.
Allgemeiner Beginn der Verjährungsfrist
Grundsätzlich beginnt die dreijährige Verjährungsfrist am Ende des Jahres, in dem Ihr Anspruch auf Rückzahlung entstanden ist. Gleichzeitig müssen Sie als Mieter von den Umständen, die diesen Anspruch begründen, Kenntnis erlangt haben oder hätten diese Kenntnis ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müssen.
Spezifische Situation bei Nebenkostenabrechnungen
Im Mietrecht ist für die Abrechnung der Nebenkosten der Abrechnungszeitraum entscheidend, der meist ein Kalenderjahr umfasst. Der Vermieter hat nach dem Ende dieses Abrechnungszeitraums zwölf Monate Zeit, um die Nebenkostenabrechnung zu erstellen und Ihnen zuzusenden.
Was bedeutet das für Ihre Rückforderung von Nebenkosten?
Ihr Anspruch auf Rückzahlung kann in verschiedenen Konstellationen entstehen, und der Beginn der Verjährungsfrist richtet sich danach:
- Sie haben ein Guthaben (Geld zurück) aufgrund einer ordnungsgemäß vorgelegten Nebenkostenabrechnung:
- Wenn der Vermieter Ihnen eine korrekte Nebenkostenabrechnung zukommen lässt, die ein Guthaben zu Ihren Gunsten ausweist, entsteht Ihr Anspruch auf Auszahlung dieses Guthabens in dem Moment, in dem Ihnen diese Abrechnung ordnungsgemäß zugestellt wird.
- Die dreijährige Verjährungsfrist für diesen Rückzahlungsanspruch beginnt dann am Ende des Jahres, in dem Sie die Abrechnung mit dem Guthaben erhalten haben.
- Der Vermieter legt keine Nebenkostenabrechnung oder eine verspätete Abrechnung vor, und Sie möchten Vorauszahlungen zurückfordern:
- Wenn der Vermieter die gesetzliche Frist von zwölf Monaten nach Ende des Abrechnungszeitraums verstreichen lässt, ohne eine ordnungsgemäße Abrechnung vorzulegen, kann er keine Nachforderungen mehr von Ihnen verlangen.
- Gleichzeitig kann Ihr Anspruch auf Rückzahlung der von Ihnen geleisteten Vorauszahlungen für diesen Zeitraum entstehen, weil der Vermieter seine Abrechnungspflicht nicht erfüllt hat und die Berechtigung der Vorauszahlungen somit nicht mehr nachweisen kann.
- In diesem Fall entsteht Ihr Anspruch auf Rückzahlung der Vorauszahlungen nicht erst, wenn eine späte Abrechnung kommt, sondern bereits mit dem Ablauf der zwölfmonatigen Abrechnungsfrist des Vermieters.
- Ein Beispiel hierfür: Wenn die Nebenkosten für das Abrechnungsjahr 2023 (das am 31. Dezember 2023 endete) abgerechnet werden müssten, hätte die Abrechnung spätestens am 31. Dezember 2024 bei Ihnen sein müssen. Wenn bis dahin keine Abrechnung vorliegt, entsteht Ihr Anspruch auf Rückzahlung der Vorauszahlungen für 2023 am 1. Januar 2025. Die dreijährige Verjährungsfrist für diesen Rückzahlungsanspruch beginnt dann am 31. Dezember 2025 und läuft bis zum 31. Dezember 2028.
Dieser Ablauf verdeutlicht, dass der Beginn der Verjährungsfrist für Ihre Rückforderung nicht immer davon abhängt, wann eine Abrechnung (eventuell verspätet) vom Vermieter vorgelegt wird, sondern vielmehr davon, wann der zugrundeliegende Anspruch nach den gesetzlichen Regelungen tatsächlich entstanden ist. Dies ist für Sie von großer Bedeutung, um Ihre eigenen Fristen korrekt einschätzen zu können.
Was passiert, wenn mein Mietvertrag die Nebenkostenabrechnung unklar regelt oder Passagen gestrichen sind?
Ein Mietvertrag ist die rechtliche Grundlage des Mietverhältnisses. Wenn Bestimmungen zur Nebenkostenabrechnung darin unklar formuliert sind oder sogar Passagen gestrichen wurden, hat dies oft weitreichende Folgen zugunsten des Mieters, da der Vermieter die Last der klaren Vereinbarung trägt.
Unklare Regelungen und deren Auslegung
Mietverträge enthalten häufig vorformulierte Standardklauseln, die als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten. Das Gesetz verlangt, dass solche Klauseln klar und verständlich sind. Wenn eine Klausel zur Umlage von Nebenkosten unklar oder mehrdeutig ist, gilt ein wichtiger rechtlicher Grundsatz: Unklarheiten gehen zulasten des Verwenders. Das bedeutet, wenn eine Bestimmung im Vertrag auf verschiedene Weisen verstanden werden kann, wird diejenige Auslegung gewählt, die für denjenigen, der den Vertrag erstellt hat (in der Regel der Vermieter), am ungünstigsten ist.
Für Sie als Mieter bedeutet das: Ist nicht eindeutig geregelt, welche Nebenkosten Sie über die Grundmiete hinaus zahlen sollen, oder die Formulierung ist so schwammig, dass verschiedene Interpretationen möglich sind, dann werden diese Unklarheiten in der Regel zu Ihren Gunsten ausgelegt. Dies kann dazu führen, dass Sie die strittigen Nebenkosten nicht zahlen müssen, weil eine klare und wirksame Vereinbarung darüber fehlt.
Auswirkungen gestrichener Passagen
Wenn Passagen oder einzelne Nebenkostenpositionen im Mietvertrag gestrichen wurden, ist die Sachlage meist noch eindeutiger. Eine Streichung bedeutet in der Regel, dass die Vertragsparteien – also Vermieter und Mieter – keine Vereinbarung über die Umlage dieser spezifischen Kosten getroffen haben.
Der Vermieter kann grundsätzlich nur die Nebenkosten auf den Mieter umlegen, die ausdrücklich und wirksam im Mietvertrag vereinbart wurden. Eine gestrichene Position zeigt gerade das Gegenteil: Es gab keine Einigung, diese Kosten auf den Mieter umzulegen. Somit kann der Vermieter diese Positionen in der Nebenkostenabrechnung nicht geltend machen. Die Beweislast dafür, dass eine Umlage wirksam vereinbart wurde, liegt stets beim Vermieter. Fehlt eine klare Vereinbarung oder wurde sie gestrichen, sind die betreffenden Nebenkosten in der Regel bereits mit der Grundmiete abgegolten.
Wichtig ist daher immer, den Mietvertrag genau zu lesen und zu prüfen, welche Nebenkosten explizit aufgeführt sind und ob deren Regelung unmissverständlich ist.
Welche Rechte habe ich, wenn mein Vermieter die Nebenkostenabrechnung nicht oder zu spät schickt?
Wenn Ihr Vermieter die jährliche Nebenkostenabrechnung nicht oder zu spät zustellt, haben Sie als Mieterin oder Mieter bestimmte Rechte. Die Frist für die Zustellung der Nebenkostenabrechnung beträgt zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums. Endet der Abrechnungszeitraum zum Beispiel am 31. Dezember 2023, muss die Abrechnung spätestens am 31. Dezember 2024 bei Ihnen sein.
Folgen bei Fristversäumnis durch den Vermieter
Wird diese Frist vom Vermieter nicht eingehalten, treten wichtige Konsequenzen ein:
- Keine Nachforderung möglich: Der Vermieter verliert das Recht, von Ihnen Nachzahlungen für die betreffende Abrechnungsperiode zu verlangen. Das bedeutet: Auch wenn die Abrechnung ergeben hätte, dass Sie zu wenig Vorauszahlungen geleistet haben, kann der Vermieter diesen Betrag nicht mehr einfordern.
- Recht zur Zurückhaltung zukünftiger Vorauszahlungen: Sie als Mieterin oder Mieter sind berechtigt, künftige monatliche Nebenkostenvorauszahlungen zurückzuhalten. Dieses Recht besteht, solange der Vermieter die ausstehende Nebenkostenabrechnung nicht korrekt erstellt und Ihnen zugesandt hat. Sie dürfen die Vorauszahlungen so lange einbehalten, bis die Abrechnung vorliegt.
- Recht auf Rückforderung aller Vorauszahlungen: Wenn der Vermieter die Abrechnung auch nach Ablauf der Frist nicht erstellt, können Sie alle bereits geleisteten Vorauszahlungen für den betreffenden Abrechnungszeitraum zurückverlangen. Dieses Recht entsteht, weil der Vermieter seine Pflicht zur Abrechnung nicht erfüllt hat und Sie somit nicht prüfen können, ob Ihre Zahlungen gerechtfertigt waren. Dieses Rückforderungsrecht besteht, sobald die Zwölfmonatsfrist abgelaufen ist und keine Abrechnung vorliegt.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie bei einer verspäteten oder fehlenden Abrechnung nicht einfach die Vorauszahlungen einstellen sollten, ohne den Vermieter vorher auf die fehlende Abrechnung hingewiesen zu haben. Die Rechte zum Zurückbehalten oder zur Rückforderung der Vorauszahlungen entstehen jedoch direkt aus der Fristversäumnis des Vermieters.
Wie lange habe ich Zeit, eine erhaltene Nebenkostenabrechnung zu prüfen und zu beanstanden?
Sobald Sie als Mieterin oder Mieter eine Nebenkostenabrechnung erhalten haben, beginnt für Sie eine wichtige Frist zu laufen. Sie haben zwölf Monate Zeit, um diese Abrechnung zu prüfen und gegebenenfalls Einwände oder Widerspruch einzulegen. Diese Frist ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB) festgelegt und beginnt mit dem Zugang der Abrechnung bei Ihnen.
Die Frist zur Prüfung und zum Widerspruch
Innerhalb dieser zwölfmonatigen Einwendungsfrist müssen Sie alle Punkte der Nebenkostenabrechnung genau überprüfen. Das betrifft sowohl die formalen Aspekte der Abrechnung – also ob sie alle notwendigen Angaben enthält – als auch deren inhaltliche Richtigkeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Abrechnung Fehler aufweist, sei es bei der Berechnung, bei den einzelnen Posten oder bei der Verteilung der Kosten, müssen Sie dies innerhalb dieser Frist Ihrem Vermieter mitteilen.
Bedeutung der Frist für Mieterinnen und Mieter
Die Einhaltung dieser Frist ist von entscheidender Bedeutung. Versäumen Sie es, innerhalb der zwölf Monate Widerspruch einzulegen, gilt die Nebenkostenabrechnung grundsätzlich als von Ihnen anerkannt. Dies gilt auch dann, wenn die Abrechnung tatsächlich gravierende Fehler enthält. Das bedeutet, dass Sie Ihre Ansprüche auf eine Korrektur der Abrechnung oder auf eine mögliche Rückzahlung von Guthaben nach Ablauf dieser Frist in der Regel verlieren. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken erst nach 14 Monaten einen klaren Fehler: Ohne fristgerechten Widerspruch könnten Sie diesen Fehler dann nicht mehr geltend machen. Diese Regelung soll für beide Seiten, also für Mieter und Vermieter, Rechtssicherheit schaffen und abschließende Klarheit über die Nebenkosten ermöglichen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (hier meistens der Vermieter) der anderen Partei (dem Mieter) stellt, ohne dass diese individuell verhandelt werden. AGB müssen klar und verständlich formuliert sein, damit der Vertragspartner weiß, welche Pflichten und Rechte er hat. Wenn eine Klausel unklar oder mehrdeutig ist, wird sie zu Gunsten des Vertragspartners ausgelegt, da Unklarheiten „zulasten des Verwenders“ gehen (§ 305c BGB). Im vorliegenden Fall bedeutet dies: Ist die Nebenkostenregelung im Mietvertrag unklar, gilt die Auslegung, die dem Mieter am wenigsten Nachteil bringt.
Beispiel: Beim Abschluss eines Handyvertrags akzeptieren Sie standardisierte Geschäftsbedingungen, die nicht individuell verhandelt werden. Wenn eine Klausel unverständlich ist, wird sie so ausgelegt, dass sie für Sie als Kunde günstig ist.
Einrede der Verjährung
Die Einrede der Verjährung ist ein Recht, mit dem ein Schuldner (hier der Vermieter) geltend macht, dass eine Forderung des Gläubigers (hier der Mieter) nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann, weil die gesetzliche Verjährungsfrist abgelaufen ist (§ 214 BGB). Die Verjährung beendet das Recht auf gerichtliche Vollstreckung, der Anspruch selbst kann aber weiterhin bestehen. Für Nebenkostenrückforderungen beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre (§ 195 BGB), beginnend am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Die Einrede schützt den Vermieter vor Ansprüchen, die zu lange zurückliegen, und sorgt für Rechtssicherheit.
Beispiel: Forderungen aus dem Jahr 2010 können Anfang 2014 verjähren, wenn der Mieter bis dahin keine Klage erhoben hat und der Vermieter die Verjährung geltend macht.
Verjährungsfrist
Die Verjährungsfrist ist der Zeitraum, nach dessen Ablauf ein Anspruch nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann (§ 195 BGB). Sie beginnt grundsätzlich mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Umständen Kenntnis erlangt oder hätte erlangen müssen (§ 199 BGB). Für die Rückforderung von Nebenkostenvorauszahlungen beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre. Im Mietrecht beginnt diese Frist entweder mit Zugang einer korrekten Nebenkostenabrechnung oder – wenn keine Abrechnung erfolgt – mit Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Abrechnungsfrist (zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums). Das verhindert, dass Vermieter durch verspätete Abrechnungen die Ansprüche unbegrenzt hinausschieben können.
Beispiel: Endet der Abrechnungszeitraum am 31.12.2023, muss die Abrechnung spätestens am 31.12.2024 beim Mieter sein. Wird sie später nicht erstellt, entsteht der Rückforderungsanspruch ab dem 01.01.2025, und die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres 2025.
Einwendungsfrist
Die Einwendungsfrist bezeichnet die gesetzliche Frist, innerhalb der ein Mieter gegen eine Nebenkostenabrechnung Einwände (zum Beispiel Fehler oder Unstimmigkeiten) erheben muss (§ 556 Abs. 3 Satz 5 BGB). Sie beträgt zwölf Monate nach Zugang der Abrechnung. Verpasst der Mieter diese Frist, gilt die Abrechnung als anerkannt, und spätere Beanstandungen sind ausgeschlossen – selbst wenn die Abrechnung fehlerhaft ist. Diese Frist dient dazu, schnell Rechtssicherheit für beide Seiten zu schaffen und langwierige Streitigkeiten zu vermeiden.
Beispiel: Erhält ein Mieter im Juni 2023 die Abrechnung für das Jahr 2022, muss er bis Juni 2024 mögliche Fehler der Abrechnung nennen, sonst verliert er seine Ansprüche gegen die Abrechnung.
Umlageschlüssel
Der Umlageschlüssel ist die Regel, nach der die Nebenkosten auf die einzelnen Mieter verteilt werden. Er legt fest, wieviel jeder Mieter anteilig von den Gesamtkosten zu zahlen hat – beispielsweise nach Wohnfläche, Anzahl der Personen oder pauschal. Der Umlageschlüssel muss im Mietvertrag oder in der Betriebskostenabrechnung eindeutig festgelegt sein, damit klar ist, wie viel jeder zahlen muss. Fehlt eine wirksame Regelung hierzu, ist die Umlage der betreffenden Nebenkosten unwirksam, und der Mieter muss diese Kosten nicht tragen.
Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus werden Müllgebühren nach Quadratmetern verteilt; ein Mieter mit 50 m² zahlt also weniger als ein Mieter mit 75 m² Wohnfläche, wenn dieser Schlüssel vereinbart ist. Wird keine Verteilung angegeben oder das Feld durchgestrichen, kann der Vermieter diese Kosten nicht auf die Mieter umlegen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 305 ff. BGB, insbesondere § 305c Abs. 2 BGB und § 307 BGB): Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen stellt, um sie für eine Vielzahl von Verträgen zu verwenden. Das Gesetz schützt die schwächere Partei vor unangemessenen Benachteiligungen durch solche Klauseln. Eine wichtige Regelung besagt, dass Unklarheiten in AGB zulasten desjenigen gehen, der sie gestellt hat (Unklarheitenregel). Außerdem sind Klauseln unwirksam, die den Vertragspartner entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. → Bedeutung im vorliegenden Fall: Da der Mietvertrag ein Formularvertrag mit gestrichenen Passagen war und Unklarheiten aufwies, entschied das Gericht nach den Regeln der AGB-Kontrolle, dass keine wirksame Pflicht zur Zahlung kalter Betriebskosten bestand.
- Grundsatz der Ungerechtfertigten Bereicherung (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 812 Abs. 1 Satz 1 Var. 1 BGB): Dieser Grundsatz besagt, dass jemand, der etwas ohne rechtlichen Grund auf Kosten eines anderen erlangt hat, dies an den anderen zurückgeben muss. Er dient dazu, Vermögensverschiebungen rückgängig zu machen, die keine rechtliche Grundlage haben. Es ist dabei unerheblich, ob der Bereicherte gutgläubig war oder nicht. → Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Mieterin Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten leistete, ohne dass eine wirksame vertragliche Grundlage dafür bestand, konnte sie die gezahlten Beträge nach diesem Grundsatz vom Vermieter zurückfordern.
- Betriebskostenabrechnung und Abrechnungsfrist (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 556 Abs. 3 BGB): Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, über die Vorauszahlungen der Betriebskosten jährlich abzurechnen. Diese Abrechnung muss dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums zugehen. Hält der Vermieter diese Frist nicht ein, kann der Mieter alle geleisteten Vorauszahlungen zurückverlangen, es sei denn, die Verspätung ist nicht zu vertreten. → Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Versäumen der Abrechnungsfrist führte dazu, dass der Rückforderungsanspruch der Mieterin für die Vorauszahlungen fällig wurde, was den Beginn der Verjährungsfrist beeinflusste.
- Verjährung (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 195, 199 BGB): Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Zeit nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann, wenn der Schuldner sich auf die Verjährung beruft. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt grundsätzlich mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Die Geltendmachung des Anspruchs durch Klageerhebung kann die Verjährung hemmen, also den Fristablauf stoppen. → Bedeutung im vorliegenden Fall: Die dreijährige Verjährungsfrist war entscheidend dafür, welche der Rückforderungsansprüche der Mieterin gegen den Vermieter noch durchsetzbar waren und welche bereits „veraltet“ waren.
- Einwendungsfrist des Mieters (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 556 Abs. 3 Satz 5 BGB und § 556 Abs. 3 Satz 6 BGB): Nach Erhalt einer Betriebskostenabrechnung hat der Mieter eine Frist von zwölf Monaten, um Einwendungen gegen deren Inhalt zu erheben. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen des Mieters grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, der Vermieter hat die verspätete Geltendmachung zu vertreten. Diese Regelung soll Rechtssicherheit schaffen. → Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Mieterin hatte für das Jahr 2013 eine Nebenkostenabrechnung erhalten und versäumt, innerhalb der zwölfmonatigen Frist Einwendungen zu erheben, wodurch ihr Anspruch für dieses Jahr ausgeschlossen war.
Das vorliegende Urteil
LG Berlin – Az.: 63 S 206/16 – Urteil vom 21.03.2017
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.