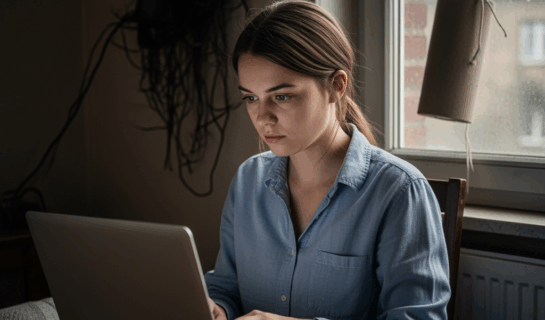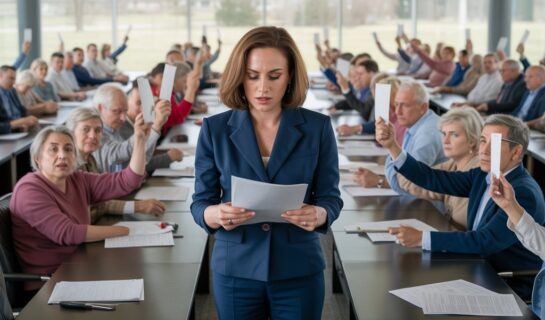Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Was passiert, wenn Paare sich trennen, aber der gemeinsame Mietvertrag weiterläuft?
- Wie kam es überhaupt zu diesem Streit vor Gericht?
- Was genau forderte die Klägerin und was wollte der Beklagte?
- Wie hat das Gericht entschieden – und wer musste was bezahlen?
- Warum musste der ausgezogene Partner weiterhin die halbe Miete zahlen?
- Aber warum musste die Klägerin nicht die volle Miete übernehmen, obwohl sie allein in der Wohnung blieb?
- Warum musste die Klägerin trotzdem bei der Kündigung des Mietvertrags mitwirken?
- Wieso wurden die übrigen Geldforderungen des Beklagten abgewiesen?
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Muss der ausgezogene Partner weiterhin seinen Mietanteil zahlen, obwohl er nicht mehr in der Wohnung lebt?
- Kann ich den gemeinsamen Mietvertrag alleine kündigen, wenn mein Partner die Zusammenarbeit verweigert?
- Welche Rolle spielt ein Kündigungsausschluss im Mietvertrag bei einer Trennung?
- Warum wird eine nichteheliche Lebensgemeinschaft bei der Beendigung des Mietvertrags oft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrachtet?
- Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn mein Ex-Partner seine Pflichten aus dem gemeinsamen Mietvertrag nicht erfüllt?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 911 C 245/17 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: AG Hamburg-St. Georg
- Datum: 13.09.2018
- Aktenzeichen: 911 C 245/17
- Verfahren: Klageverfahren
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Schuldrecht, Gesellschaftsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ehemalige Partnerin einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft; forderte vom Beklagten die hälftige Mietzahlung für die Monate Februar bis Mai 2017.
- Beklagte: Ehemaliger Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft; bestritt seine weitere Mietpflicht, forderte die Klägerin auf, die Miete allein zu tragen, und verlangte widerklagend ihre Mitwirkung an der Kündigung des Mietverhältnisses sowie Ausgleich von Nebenkosten und Anwaltskosten.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Nach der Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft stritten die ehemaligen Partner über die Fortzahlung der Miete für eine gemeinsam angemietete Wohnung und die Beendigung des Mietverhältnisses, welches einen Kündigungsausschluss enthielt. Der Beklagte war ausgezogen und hatte seine Mietzahlungen eingestellt.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Ging es um die finanziellen Verpflichtungen und Mitwirkungspflichten ehemaliger Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft aus einem gemeinsamen Mietvertrag nach ihrer Trennung, insbesondere hinsichtlich der anteiligen Mietzahlungen und der Beendigung des Mietverhältnisses trotz eines Kündigungsausschlusses?
Wie hat das Gericht entschieden?
- Klage stattgegeben, Widerklage teilweise stattgegeben und im Übrigen abgewiesen: Der Beklagte muss der Klägerin die Hälfte der Mietzahlungen für Februar bis Mai 2017 nebst Zinsen zahlen. Die Klägerin muss wiederum mit dem Beklagten gemeinsam das Mietverhältnis zum frühestmöglichen Zeitpunkt kündigen. Andere Widerklageanträge wurden abgewiesen.
- Kernaussagen der Begründung:
- Hälftige Mietpflicht bleibt bestehen: Der ausgezogene Partner bleibt im Innenverhältnis verpflichtet, seinen Anteil an der Miete zu zahlen, da sein Auszug ihn nicht von dieser Pflicht entbindet und keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
- Anspruch auf Mitwirkung bei Kündigung: Nach dem Scheitern der nichtehelichen Lebensgemeinschaft haben beide Partner das Recht, die Mitwirkung des anderen bei der Kündigung des gemeinsamen Mietverhältnisses zu verlangen, auch wenn ein Kündigungsausschluss besteht (dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt).
- Kein Freistellungsanspruch für Ausgezogenen: Ein Freistellungsanspruch des ausgezogenen Partners, der ihn von der Mietzahlung befreien würde, wurde verneint, insbesondere da die gemeinsame Anmietung von der Solvenz beider (plus Eltern) abhing und die Parteien die langfristige Bindung bewusst eingegangen waren.
Der Fall vor Gericht
Was passiert, wenn Paare sich trennen, aber der gemeinsame Mietvertrag weiterläuft?
Stellen Sie sich vor, ein unverheiratetes Paar mietet gemeinsam eine Wohnung. Die Beziehung geht in die Brüche, einer der beiden Partner zieht aus. Doch was geschieht mit dem Mietvertrag, der von beiden unterschrieben wurde und vielleicht sogar eine lange Kündigungsfrist hat? Wer muss die Miete zahlen? Kann der ausgezogene Partner einfach aufhören zu zahlen, weil er die Wohnung nicht mehr nutzt? Mit genau diesen Fragen musste sich das Amtsgericht Hamburg-St. Georg in einem Urteil befassen. Es ging um eine gescheiterte Beziehung und die finanziellen Folgen, die ein gemeinsamer Mietvertrag mit sich bringt.
Wie kam es überhaupt zu diesem Streit vor Gericht?

Ein Mann und eine Frau, die als Paar zusammenlebten, ohne verheiratet zu sein, unterschrieben im Januar 2016 gemeinsam einen Mietvertrag für eine Dreizimmerwohnung mit zwei Parkplätzen. Da ihre eigenen Finanzen für den Vermieter nicht ausreichten, traten auch die Eltern des Mannes als Mieter in den Vertrag ein, um zusätzliche Sicherheit zu geben. Die monatliche Miete von knapp 940 Euro wollten sich der Mann und die Frau intern hälftig teilen. Eine Besonderheit des Vertrags war ein sogenannter Kündigungsausschluss. Das bedeutet, die Mieter und der Vermieter vereinbarten, dass der Vertrag für eine bestimmte Zeit nicht gekündigt werden kann – in diesem Fall bis zum 30. September 2019.
Im September 2016, nur wenige Monate nach dem Einzug, trennte sich das Paar und der Mann zog aus. Zunächst lief alles noch geregelt ab. Die Frau blieb in der Wohnung und zahlte ihren Mietanteil weiterhin an den Mann, der die gesamte Miete an den Vermieter überwies.
Doch die Situation spitzte sich zu. Im November 2016 forderte der Anwalt des Mannes die Frau auf, bei der Beendigung des Mietverhältnisses mitzuwirken. Da eine normale Kündigung ja ausgeschlossen war, blieb nur die Möglichkeit, einen Nachmieter zu finden, dem der Vermieter zustimmen müsste. Die Frau stimmte zu und ermöglichte Besichtigungstermine, aber es fand sich kein passender Nachmieter. Die Hausverwaltung bestätigte schriftlich, dass eine Kündigung erst Ende September 2019 möglich sei.
Anfang 2017 änderte sich die Zahlungsweise: Beide überwiesen ihre Mietanteile nun direkt an den Vermieter. Doch im Februar eskalierte der Streit. Der Mann warf seine Wohnungsschlüssel in den Briefkasten der gemeinsamen Wohnung und stellte seine Mietzahlungen komplett ein. Sein Anwalt teilte der Frau mit, er gehe davon aus, dass sie die Wohnung nun allein nutzen wolle und daher auch die gesamte Miete allein zahlen müsse.
Was genau forderte die Klägerin und was wollte der Beklagte?
Die Frau, die nun die volle Miete allein zahlte, um keine Mietschulden beim Vermieter anzuhäufen, zog vor Gericht. Sie war die Klägerin, also die Person, die eine Klage einreicht. Sie forderte von ihrem Ex-Partner, dem Beklagten, seinen Mietanteil für die Monate Februar bis Mai 2017 zurück – insgesamt knapp 1.800 Euro. Ihre Begründung war einfach: Beide hätten den Vertrag unterschrieben, beide hätten sich intern auf eine hälftige Teilung geeinigt und sein Auszug ändere nichts an seiner vertraglichen Pflicht.
Der Beklagte forderte das Gericht auf, die Klage abzuweisen. Er war der Meinung, er müsse nichts mehr zahlen. Da die Klägerin die Wohnung allein weiter nutze, müsse sie auch allein dafür aufkommen. Zusätzlich erhob er eine sogenannte Widerklage. Das ist eine eigene Klage, die der Beklagte im selben Gerichtsverfahren gegen den Kläger erhebt. Mit seiner Widerklage verlangte er drei Dinge:
- Die Klägerin sollte dazu verurteilt werden, gemeinsam mit ihm die Kündigung des Mietvertrags zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszusprechen.
- Sie sollte ihm 122 Euro für eine angebliche Nebenkostennachzahlung erstatten.
- Sie sollte ihm seine Anwaltskosten von über 1.300 Euro ersetzen, da sie ihn durch ihre mangelnde Kooperation gezwungen habe, einen Anwalt einzuschalten.
Wie hat das Gericht entschieden – und wer musste was bezahlen?
Das Gericht fällte ein differenziertes Urteil. Es gab der Klage der Frau vollständig statt, der Widerklage des Mannes aber nur in einem einzigen Punkt.
Im Detail sah die Entscheidung so aus:
- Der Beklagte wurde verurteilt, der Klägerin die geforderten 1.799,20 Euro für die ausstehenden Mietanteile zu zahlen, zuzüglich Zinsen.
- Bezüglich der Widerklage wurde die Klägerin verurteilt, gemeinsam mit dem Beklagten die Kündigung des Mietvertrages zum nächstmöglichen Termin (dem 30. September 2019) zu erklären.
- Die weiteren Forderungen des Beklagten aus seiner Widerklage – also die Zahlung der Nebenkosten und der Anwaltskosten – wurden abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits wurden aufgeteilt: Die Klägerin musste 3/5 und der Beklagte 2/5 der gesamten Kosten tragen. Diese Aufteilung spiegelt wider, wer in welchem Umfang mit seinen Forderungen Erfolg hatte.
Warum musste der ausgezogene Partner weiterhin die halbe Miete zahlen?
Das Gericht erklärte seine Entscheidung sehr genau. Der Anspruch der Klägerin auf die halbe Miete war aus Sicht des Gerichts vollkommen berechtigt. Um das zu verstehen, muss man sich ansehen, wie das Gesetz eine solche Situation bewertet.
Wenn zwei Personen gemeinsam einen Mietvertrag unterschreiben, sind sie sogenannte Gesamtschuldner. Das kann man sich wie bei einem gemeinsam aufgenommenen Kredit vorstellen: Die Bank kann sich aussuchen, von wem sie das Geld verlangt – von einem allein oder von beiden zu Teilen. Dem Vermieter gegenüber haftet also jeder Mieter für die volle Miete. Wenn einer nicht zahlt, kann der Vermieter das gesamte Geld vom anderen fordern.
Intern, also zwischen den beiden Mietern, gilt aber das, was sie vereinbart haben. Hier war unbestritten, dass sie die Miete hälftig teilen wollten. Als die Klägerin ab Februar 2017 die volle Miete zahlte, beglich sie damit auch die Schulden ihres Ex-Partners beim Vermieter. Dadurch entstand ihr nach dem Gesetz (§ 426 Bürgerliches Gesetzbuch) automatisch ein Anspruch auf Erstattung gegen ihn. Sein Auszug aus der Wohnung änderte daran nichts, denn der Mietvertrag lief ja unverändert weiter.
Aber warum musste die Klägerin nicht die volle Miete übernehmen, obwohl sie allein in der Wohnung blieb?
Das war der Kernpunkt der Verteidigung des Beklagten. Er argumentierte, dass derjenige, der den Vorteil aus der Wohnung zieht – also darin wohnt –, auch die gesamten Kosten tragen müsse. Er forderte von ihr eine sogenannte Freistellung, also die Befreiung von seiner Zahlungspflicht. In manchen Fällen geben Gerichte einem solchen Argument sogar recht. Aber hier sah das Gericht die Sache anders, und zwar aus drei entscheidenden Gründen:
- Die finanzielle Situation: Das Gericht betonte, dass das Paar die Wohnung nur hatte anmieten können, weil die Eltern des Mannes als finanzielle Absicherung mit in den Vertrag eingetreten waren. Das zeigte dem Gericht, dass keiner von beiden die Miete allein hätte stemmen können. Bei solchen Paaren, so die Richter, steht bei einer Trennung nicht der Wunsch im Vordergrund, die teure Wohnung zu behalten. Viel wichtiger ist der Gedanke: „Ich möchte auf keinen Fall allein für eine Miete haften, die ich mir nicht leisten kann.“ Würde man dem Partner, der zuerst auszieht, erlauben, sich aus der Zahlungspflicht zu stehlen, würde das ein „Wettrennen um den schnellsten Auszug“ provozieren. Das wäre unfair.
- Die bewusste gemeinsame Verpflichtung: Beide Partner hatten wissentlich einen Vertrag mit einem langfristigen Kündigungsausschluss unterschrieben. Sie haben sich also bewusst gemeinsam an diese Wohnung und die damit verbundenen Kosten gebunden. Auf diese gemeinsame Entscheidung durfte sich die Klägerin verlassen. Es war kein Rechtsmissbrauch, wenn sie nach der Trennung in der Wohnung blieb, anstatt sofort auf die Straße zu ziehen.
- Kein Unterhaltsanspruch: Das Gericht wies auch das Argument zurück, die Forderung der Frau käme einer Art Unterhaltszahlung gleich. Denn der Beklagte zahlte nicht einfach nur Geld ins Leere. Für seine Mietzahlung behielt er weiterhin das Recht, die Wohnung zu nutzen. Dass er dieses Recht freiwillig nicht wahrnahm, war seine eigene Entscheidung.
Das Gericht fasste zusammen: Die vom Paar gemeinsam gewollte langfristige Bindung durch den Kündigungsausschluss muss auch im Verhältnis zwischen den beiden Partnern nach der Trennung fair berücksichtigt werden.
Warum musste die Klägerin trotzdem bei der Kündigung des Mietvertrags mitwirken?
Obwohl die Klägerin mit ihrer Geldforderung vollständig Recht bekam, hatte der Beklagte mit einem Teil seiner Widerklage Erfolg: Die Klägerin wurde verpflichtet, an der Kündigung mitzuwirken. Wie passt das zusammen?
Das Gericht erklärte, dass eine nichteheliche Lebensgemeinschaft rechtlich wie eine kleine Firma oder Partnerschaft behandelt wird, eine sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Auch wenn das Paar keinen schriftlichen Gesellschaftsvertrag hatte, entstand diese GbR automatisch durch den gemeinsamen Lebenszweck. Mit der Trennung des Paares war der Zweck dieser „Gesellschaft“ – das Zusammenleben – gescheitert und die GbR damit beendet.
Nach der Auflösung einer solchen Gesellschaft hat jeder Partner das Recht zu verlangen, dass alle gemeinsamen Verpflichtungen beendet werden. Dazu gehört auch der gemeinsame Mietvertrag. Deshalb hatte der Beklagte grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass die Klägerin an der Kündigung mitwirkt. Da eine sofortige Kündigung wegen des Kündigungsausschlusses nicht möglich war, konnte die Kündigung nur zum nächstmöglichen Zeitpunkt erklärt werden.
Wieso wurden die übrigen Geldforderungen des Beklagten abgewiesen?
Die anderen beiden Punkte seiner Widerklage scheiterten an einfachen Hürden, die das Gericht klar benannte:
- Die Nebenkostennachforderung (122 Euro): Der Beklagte hatte zwar behauptet, eine Nebenkostennachzahlung für das Jahr 2016 allein beglichen zu haben, legte dafür aber keinerlei Beweise vor. Er kündigte an, einen Kontoauszug nachzureichen, tat dies aber nicht. Ohne Beweis konnte das Gericht ihm das Geld nicht zusprechen.
- Die Anwaltskosten (über 1.300 Euro): Der Beklagte argumentierte, er habe die Anwaltskosten als Schaden erlitten, weil die Klägerin nicht auf seine Aufforderungen reagiert habe. Das Gericht prüfte jedoch das Datum des ersten Anwaltsschreibens. Es stellte fest, dass der Anwalt bereits tätig wurde, bevor überhaupt eine von ihm gesetzte Frist abgelaufen war. Die Kosten waren also nicht die Folge einer Pflichtverletzung der Klägerin, sondern entstanden durch die eigenständige Entscheidung des Beklagten, frühzeitig einen Anwalt zu beauftragen. Somit konnte er diese Kosten nicht von ihr zurückfordern.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg verdeutlicht wesentliche Rechtsprinzipien für unverheiratete Paare bei gemeinsamen Mietverträgen nach einer Trennung.
- Gesamtschuldnerschaft bleibt trotz Trennung bestehen: Das Urteil bestätigt, dass die einseitige Beendigung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft die vertraglichen Verpflichtungen aus gemeinsam unterschriebenen Mietverträgen nicht automatisch aufhebt. Wer auszieht, bleibt weiterhin zur anteiligen Mietzahlung verpflichtet, wenn eine interne Kostenteilung vereinbart war.
- Finanzielle Ausgangslage verhindert Freistellung: Das Gericht etabliert den Grundsatz, dass bei Paaren, die eine Wohnung nur gemeinsam finanzieren konnten, derjenige Partner nicht von der Zahlungspflicht befreit wird, der zuerst auszieht. Dies soll ein „Wettrennen um den schnellsten Auszug“ verhindern und die schwächere finanzielle Position des verbleibenden Partners schützen.
- Auflösung erfordert beidseitige Mitwirkung: Daraus folgt, dass nach dem Ende einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zwar beide Partner zur gemeinsamen Vertragsbeendigung verpflichtet sind, aber bis zur tatsächlichen Kündigung die ursprünglich vereinbarte Kostenteilung fortbesteht.
Dieses Urteil schafft Rechtssicherheit für unverheiratete Paare und unterstreicht, dass langfristige gemeinsame Verpflichtungen nicht einseitig durch Beziehungsende aufgelöst werden können.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Muss der ausgezogene Partner weiterhin seinen Mietanteil zahlen, obwohl er nicht mehr in der Wohnung lebt?
Ja, in der Regel bleibt der ausgezogene Partner weiterhin zur Mietzahlung verpflichtet, auch wenn er nicht mehr in der Wohnung lebt. Der Auszug allein beendet die Mietzahlungspflicht gegenüber dem Vermieter nicht.
Die Verpflichtung gegenüber dem Vermieter bleibt bestehen
Wenn Sie und Ihr Partner den Mietvertrag gemeinsam unterschrieben haben, sind Sie beide – auch nach einer Trennung und dem Auszug eines Partners – dem Vermieter gegenüber voll verantwortlich für die gesamte Miete. Juristisch spricht man hier von einer sogenannten Gesamtschuldnerschaft. Das bedeutet, der Vermieter kann die gesamte Miete von jedem der beiden Mieter fordern, unabhängig davon, wer gerade in der Wohnung lebt. Es spielt für den Vermieter keine Rolle, wer von Ihnen aus der Wohnung ausgezogen ist oder welche internen Absprachen Sie getroffen haben.
Für Sie bedeutet das: Auch wenn Sie ausgezogen sind, kann der Vermieter von Ihnen die gesamte ausstehende Miete verlangen, falls der verbleibende Partner diese nicht zahlt. Der Vermieter muss sich nicht erst an den in der Wohnung lebenden Partner halten.
Interne Absprachen zwischen den Partnern
Interne Vereinbarungen zwischen den ehemaligen Partnern, wer welchen Anteil der Miete zahlt oder ob der ausgezogene Partner nichts mehr schuldet, wirken sich nicht direkt auf die Verpflichtung gegenüber dem Vermieter aus. Solche Absprachen sind bindend für die Partner untereinander, ändern aber nichts an der Gesamtschuldnerschaft gegenüber dem Vermieter.
Was das für die Ex-Partner bedeutet: Zahlt der ausgezogene Partner weiterhin seinen Mietanteil oder sogar die ganze Miete, obwohl er nicht mehr in der Wohnung lebt, kann er unter bestimmten Umständen einen Ausgleichsanspruch gegen den verbleibenden Partner haben. Zahlt der verbleibende Partner die Miete nicht und der Vermieter fordert sie vom ausgezogenen Partner, kann der ausgezogene Partner den gezahlten Betrag, der über seinen intern vereinbarten Anteil hinausgeht, unter Umständen vom verbleibenden Partner zurückfordern.
Wie die Mietpflicht beendet werden kann
Die Mietzahlungspflicht für beide Partner endet gegenüber dem Vermieter nur, wenn der gemeinsame Mietvertrag ordentlich oder außerordentlich gekündigt wird und die Kündigungsfrist abgelaufen ist. Alternativ kann der Vermieter auch einer Entlassung eines Partners aus dem Mietvertrag zustimmen. Dies erfordert jedoch stets die Zustimmung aller Beteiligten: des Vermieters und beider Mieter. Ein einseitiger Auszug oder eine einseitige Kündigung nur durch einen der beiden Partner ist nicht ausreichend, um die gemeinsame Mietpflicht zu beenden.
Kann ich den gemeinsamen Mietvertrag alleine kündigen, wenn mein Partner die Zusammenarbeit verweigert?
Als Mieter eines gemeinsamen Mietvertrags stehen Sie grundsätzlich in einer gemeinschaftlichen Verantwortung gegenüber dem Vermieter. Dies bedeutet, dass ein gemeinsamer Mietvertrag in der Regel auch nur gemeinschaftlich von allen Mietparteien gekündigt werden kann. Eine einseitige Kündigung durch nur einen Mieter ist im Allgemeinen nicht möglich, wenn mehrere Personen den Vertrag gemeinsam unterschrieben haben. Der Vermieter kann die Wirksamkeit einer Kündigung verweigern, die nicht von allen im Vertrag genannten Mietern unterschrieben wurde.
Die rechtliche Grundlage der gemeinsamen Haftung
Wenn Sie und Ihr Partner einen Mietvertrag gemeinsam abgeschlossen haben, gelten Sie rechtlich als Gesamtschuldner. Das bedeutet, der Vermieter kann die gesamte Miete von jedem einzelnen von Ihnen fordern – nicht nur Ihren Anteil. Dies gilt auch dann, wenn einer von Ihnen auszieht. Die vertragliche Bindung und damit die Pflichten, wie die Mietzahlung, bestehen für alle Mieter fort, solange der Mietvertrag nicht wirksam beendet wurde. Für Sie bedeutet das: Auch wenn Sie aus der Wohnung ausgezogen sind, bleiben Sie weiterhin für die volle Miete haftbar, solange der Vertrag läuft und nicht ordnungsgemäß gekündigt ist.
Wege, wenn der Partner die Kooperation verweigert
Wenn eine einvernehmliche Kündigung mit Ihrem Partner nicht zustande kommt, gibt es juristische Möglichkeiten, um aus dieser vertraglichen Bindung herauszukommen. Die häufigste und in der Regel einzige Option ist die Klage auf Zustimmung zur Kündigung.
- Klage auf Zustimmung zur Kündigung: Hierbei verklagen Sie Ihren Partner auf dessen Zustimmung zur Kündigung des Mietvertrages. Das Gericht prüft dann, ob es Ihnen unter den gegebenen Umständen – oft nach einer Trennung – nicht mehr zugemutet werden kann, den gemeinsamen Mietvertrag fortzusetzen. Wenn das Gericht feststellt, dass es Ihnen unzumutbar ist, die gemeinsame Mietvertragsbeziehung aufrechtzuerhalten, kann es Ihren Partner zur Abgabe der Kündigungserklärung verurteilen oder seine Zustimmung zur Kündigung ersetzen. Dies ist ein gerichtlicher Weg, um die Weigerung des Partners zu überwinden.
- Ausgleichsansprüche: Sollte Ihr Partner in der Wohnung verbleiben und Sie nach Ihrem Auszug weiterhin zur Mietzahlung herangezogen werden oder Miete leisten müssen, können Ihnen unter Umständen Ausgleichsansprüche gegen Ihren Partner zustehen. Das bedeutet, Sie könnten von Ihrem Partner die Erstattung der Miete oder des Anteils fordern, den Sie nach Ihrem Auszug gezahlt haben, während Ihr Partner die Wohnung allein genutzt hat. Dies ist jedoch ein separates Thema vom Kündigungsprozess selbst.
Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Schritte formale juristische Verfahren sind, die einer gerichtlichen Prüfung unterliegen. Ohne die Zustimmung des Partners zur Kündigung oder einen entsprechenden Gerichtsbeschluss bleibt die gemeinsame Haftung für den Mietvertrag bestehen.
Welche Rolle spielt ein Kündigungsausschluss im Mietvertrag bei einer Trennung?
Ein Kündigungsausschluss, auch bekannt als Mindestmietdauer, ist eine vertragliche Vereinbarung im Mietvertrag. Sie legt fest, dass das Mietverhältnis für einen bestimmten Zeitraum nicht durch eine ordentliche Kündigung beendet werden kann. Das bedeutet, dass Mieter und Vermieter für die Dauer dieses Ausschlusses an den Vertrag gebunden sind. Häufig werden solche Klauseln für ein bis vier Jahre vereinbart.
Auswirkungen bei einer Trennung
Wenn ein Mietvertrag mit Kündigungsausschluss von zwei Partnern gemeinsam unterzeichnet wurde und es zu einer Trennung kommt, bleiben beide Partner grundsätzlich bis zum Ende der vereinbarten Mindestmietdauer an den Vertrag gebunden. Dies gilt auch dann, wenn einer der Partner aus der Wohnung auszieht. Der ausgezogene Partner bleibt weiterhin Mieter und ist gemeinsam mit dem verbleibenden Partner zur vollständigen Zahlung der Miete verpflichtet. Das ursprüngliche Mietverhältnis besteht unverändert fort. Die interne Vereinbarung der Partner über die Mietzahlung (z.B. der verbleibende Partner zahlt alles) ändert nichts an der Verpflichtung gegenüber dem Vermieter. Erst nach Ablauf des Kündigungsausschlusses kann der Mietvertrag unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist ordentlich gekündigt werden.
Begrenzte Möglichkeiten während des Kündigungsausschlusses
Die Möglichkeit, das Mietverhältnis trotz eines Kündigungsausschlusses vorzeitig zu beenden, ist für Mieter sehr begrenzt und erfordert oft das Entgegenkommen des Vermieters:
- Einvernehmliche Aufhebung des Mietvertrags: Die einfachste und sicherste Lösung ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter, den Mietvertrag vorzeitig aufzuheben. Dies erfordert jedoch die Zustimmung aller Beteiligten – sowohl beider Mieter als auch des Vermieters. Wenn der Vermieter zustimmt, können Sie einen Termin für die vorzeitige Vertragsbeendigung festlegen.
- Vorschlag eines geeigneten Nachmieters: Manchmal zeigt sich ein Vermieter bereit, dem Mieter aus Kulanz entgegenzukommen, wenn ein geeigneter und solventer Nachmieter vorgeschlagen wird. Ein Rechtsanspruch darauf besteht in der Regel jedoch nicht, es sei denn, der Mietvertrag sieht dies ausdrücklich vor oder es liegt ein besonderer Ausnahmefall vor. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, den vorgeschlagenen Nachmieter zu akzeptieren, muss aber bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Mieters und eines zumutbaren Nachmieters seine Zustimmung nicht ohne triftigen Grund verweigern.
- Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund: Eine Trennung oder der Auszug eines Partners stellt in der Regel keinen wichtigen Grund dar, der zu einer außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt. Ein wichtiger Grund muss so schwerwiegend sein, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Mieter unzumutbar wird. Beispiele hierfür könnten schwere Mängel der Mietsache sein, die die Gesundheit gefährden, oder schwerwiegende Störungen des Hausfriedens durch den Vermieter. Solche Gründe müssen jedoch objektiv nachweisbar sein und liegen selten im direkten Zusammenhang mit einer Trennung.
Warum wird eine nichteheliche Lebensgemeinschaft bei der Beendigung des Mietvertrags oft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) betrachtet?
Gerichte stufen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft, die gemeinsam eine Wohnung mietet, häufig als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ein. Dies mag für juristische Laien auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, hat jedoch eine klare rechtliche Logik.
Was ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)?
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) entsteht, wenn sich mindestens zwei Personen zusammenschließen, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen und diesen gemeinsam zu fördern. Dafür braucht es keinen schriftlichen Vertrag; die GbR kann auch stillschweigend durch das gemeinsame Handeln entstehen. Wenn beispielsweise zwei Personen zusammen ein Café eröffnen oder ein Auto gemeinsam kaufen und nutzen, bilden sie in der Regel eine GbR.
Nichteheliche Lebensgemeinschaft als GbR im Mietrecht
Bei einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die gemeinsam eine Wohnung anmietet, sehen die Gerichte oft ebenfalls einen solchen gemeinsamen Zweck: Das ist das gemeinsame Wohnen und Wirtschaften in der angemieteten Wohnung. Beide Partner tragen zur Miete bei, teilen sich die Kosten des Haushalts und nutzen die Wohnung gemeinsam. Durch dieses gemeinsame Ziel und die entsprechende Verhaltensweise entsteht nach Ansicht der Rechtsprechung eine stillschweigende GbR zwischen den Partnern. Der Mietvertrag über die gemeinsame Wohnung wird dann zu einem wesentlichen Bestandteil dieser GbR.
Praktische Auswirkungen bei Trennung und Mietvertragsbeendigung
Die Einordnung als GbR hat wichtige praktische Auswirkungen, insbesondere wenn die Beziehung endet und der Mietvertrag beendet werden soll:
- Gemeinsame Verantwortung für den Mietvertrag: Da der Mietvertrag ein gemeinsames „Anliegen“ der GbR ist, können die Partner den Mietvertrag in der Regel auch nur gemeinsam beenden. Das bedeutet, dass eine wirksame Kündigung des Mietvertrags dem Vermieter nur von beiden Mietern gemeinsam zugehen kann. Eine Kündigung nur durch einen der Partner ist meist unwirksam, es sei denn, der Mietvertrag sieht etwas anderes vor oder es liegen besondere Gründe vor.
- Pflicht zur Mitwirkung: Selbst wenn ein Partner auszieht, bleibt er oder sie rechtlich weiterhin Teil der GbR und damit auch Mieter der Wohnung. Die Gerichte leiten aus der GbR-Beziehung ab, dass die Partner eine gegenseitige Pflicht zur Mitwirkung haben, um die gemeinsamen Angelegenheiten der GbR (hier: den Mietvertrag) ordnungsgemäß abzuwickeln. Dies beinhaltet auch die Verpflichtung, an der gemeinsamen Kündigung des Mietvertrags mitzuwirken.
- Haftung gegenüber dem Vermieter: Beide Partner haften gegenüber dem Vermieter für die gesamte Miete als sogenannte Gesamtschuldner. Das bedeutet, der Vermieter kann sich aussuchen, von wem er die volle Miete fordert. Intern, also zwischen den Partnern der GbR, besteht jedoch in der Regel ein Anspruch auf Ausgleich, sodass jeder seinen Anteil (z.B. die Hälfte) tragen muss. Die GbR-Konstruktion stellt sicher, dass ein ausgezogener Partner nicht einfach aus der Verantwortung entlassen ist, solange der Mietvertrag nicht wirksam beendet wurde, und gleichzeitig ein Anspruch auf Mitwirkung des Ex-Partners an der Kündigung besteht, um die eigene Haftung zu beenden.
Diese richterliche Logik stellt sicher, dass die Verantwortung für den Mietvertrag auch nach der Trennung klar geregelt ist und keiner der Partner einseitig Entscheidungen treffen oder sich aus der Verantwortung ziehen kann, ohne die Rechte und Pflichten des anderen zu berücksichtigen. Es geht darum, eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden.
Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn mein Ex-Partner seine Pflichten aus dem gemeinsamen Mietvertrag nicht erfüllt?
Wenn Sie und Ihr Ex-Partner einen gemeinsamen Mietvertrag abgeschlossen haben, sind Sie in der Regel beide sogenannte Gesamtschuldner gegenüber dem Vermieter. Das bedeutet, der Vermieter kann die gesamte Miete von Ihnen beiden gemeinsam oder auch von jedem von Ihnen einzeln fordern. Zahlen Sie beispielsweise die Miete alleine, weil Ihr Ex-Partner seinen Anteil nicht leistet, kann der Vermieter von Ihnen die volle Summe verlangen.
Ausgleichsanspruch zwischen den Mietern
Haben Sie als ein Mietvertragspartner mehr gezahlt, als Sie intern mit Ihrem Ex-Partner vereinbart hatten (meistens die Hälfte der Miete), steht Ihnen ein Ausgleichsanspruch zu. Dieser Anspruch richtet sich direkt gegen Ihren Ex-Partner und nicht gegen den Vermieter.
- Praktische Auswirkung: Stellen Sie sich vor, die gesamte monatliche Miete beträgt 1.000 Euro. Intern haben Sie mit Ihrem Ex-Partner vereinbart, dass jeder 500 Euro zahlt. Wenn Ihr Ex-Partner seine 500 Euro nicht an den Vermieter überweist und Sie daraufhin die gesamten 1.000 Euro zahlen, dann haben Sie einen Anspruch auf 500 Euro von Ihrem Ex-Partner.
Durchsetzung von Zahlungsansprüchen
Wenn Ihr Ex-Partner trotz Aufforderung seine internen Verpflichtungen nicht erfüllt und Ihnen seinen Anteil nicht erstattet, können Sie diesen Ausgleichsanspruch grundsätzlich gerichtlich geltend machen. Dies erfolgt in der Regel durch eine Klage auf Zahlung des geschuldeten Betrages vor dem zuständigen Gericht.
Mitwirkungspflichten und Beendigung des Mietvertrags
Neben finanziellen Aspekten kann es auch um die Mitwirkung an der Beendigung des Mietverhältnisses gehen. Ein gemeinsamer Mietvertrag kann meist nur von allen Mietvertragspartnern gemeinsam gekündigt werden. Verweigert Ihr Ex-Partner die notwendige Unterschrift unter einer Kündigung oder die Rückgabe von Schlüsseln, kann dies zu weiteren Problemen führen, da der Vertrag dann weiterhin besteht.
- Praktische Auswirkung: Wenn Sie aus der Wohnung ausziehen möchten und Ihr Ex-Partner nicht mit der Kündigung des Mietvertrags einverstanden ist oder nicht kooperiert, bleiben Sie weiterhin als Mieter im Vertrag und haften gegenüber dem Vermieter. In solchen Fällen kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Klage auf Zustimmung zur Kündigung oder auf Mitwirkung bei der Schlüsselübergabe in Betracht kommen, um die Beendigung des Mietverhältnisses gerichtlich durchzusetzen.
Wichtiger Hinweis zur fortdauernden Haftung
Es ist entscheidend zu verstehen, dass ein bloßer Auszug aus der Wohnung die Haftung aus dem Mietvertrag gegenüber dem Vermieter nicht automatisch beendet. Solange der Mietvertrag nicht wirksam von allen Mietern gekündigt oder einvernehmlich aufgelöst ist und Ihr Name darin steht, bleiben Sie und Ihr Ex-Partner weiterhin gemeinsam für die Erfüllung aller vertraglichen Pflichten, insbesondere der Mietzahlung, verantwortlich.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Beklagten
Ein Beklagter ist die Person oder Partei, gegen die eine Klage vor Gericht eingereicht wird. Er oder sie ist diejenige, die sich gegen die Forderungen der klagenden Partei verteidigen muss. Im vorliegenden Fall war der Mann der Beklagte, weil seine Ex-Partnerin ihn auf die Zahlung seines Mietanteils verklagte.
Freistellung
Eine Freistellung ist die Befreiung einer Person von einer bestimmten Pflicht oder Haftung, insbesondere einer Zahlungspflicht. Derjenige, der eine Freistellung verlangt, möchte erreichen, dass er für eine bestimmte Schuld oder Leistung nicht mehr aufkommen muss und diese stattdessen von einer anderen Person übernommen wird. Im Text forderte der ausgezogene Partner seine Ex-Partnerin auf, ihn von der Zahlung der Miete freizustellen, da sie die Wohnung allein nutzte.
Beispiel: Ein Bürge, der für einen Kredit einspringt, könnte vom eigentlichen Schuldner die Freistellung von seiner Bürgschaft verlangen, sobald dieser in der Lage ist, die Schuld selbst zu begleichen.
Gesamtschuldner
Gesamtschuldner sind mehrere Personen, die gemeinsam für dieselbe Leistung oder Schuld haften, meistens in voller Höhe. Der Gläubiger (im Fall eines Mietvertrags der Vermieter) kann sich aussuchen, von wem er die gesamte Leistung fordert – von einem der Schuldner allein oder von allen zu Teilen. Die interne Aufteilung der Schuld unter den Gesamtschuldnern ist für den Gläubiger unerheblich. Im Fall des Mietvertrags hafteten beide Partner als Gesamtschuldner für die gesamte Miete gegenüber dem Vermieter.
Beispiel: Wenn zwei Freunde gemeinsam einen Kredit aufnehmen, sind sie Gesamtschuldner der Bank gegenüber. Die Bank kann die gesamte Rate von jedem der beiden Freunde fordern, falls der andere nicht zahlt.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) entsteht, wenn sich mindestens zwei Personen zusammenschließen, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen und diesen gemeinsam zu fördern. Dies geschieht oft stillschweigend durch ihr Verhalten, ohne dass ein schriftlicher Vertrag notwendig ist. Gerichte sehen eine nichteheliche Lebensgemeinschaft, die gemeinsam eine Wohnung mietet, oft als GbR an, weil das gemeinsame Wohnen und Wirtschaften einen gemeinsamen Zweck darstellt. Dies hat zur Folge, dass beide Partner an gemeinsame Verpflichtungen wie den Mietvertrag gebunden bleiben und sich gegenseitig zur Mitwirkung verpflichten können, etwa bei einer gemeinsamen Kündigung.
Klägerin
Eine Klägerin ist die Person oder Partei, die eine Klage vor Gericht einreicht. Sie ist diejenige, die vor Gericht bestimmte Ansprüche gegen eine andere Partei (den Beklagten) geltend macht und deren Durchsetzung fordert. Im vorliegenden Fall war die Frau die Klägerin, die von ihrem Ex-Partner die Rückzahlung der von ihr vorgestreckten Mietanteile verlangte.
Kündigungsausschluss
Ein Kündigungsausschluss ist eine vertragliche Vereinbarung im Mietvertrag, die festlegt, dass der Mietvertrag für eine bestimmte Zeit nicht ordentlich gekündigt werden kann. Beide Vertragsparteien – Mieter und Vermieter – sind für diese festgelegte Mindestdauer an den Vertrag gebunden, selbst wenn sich die persönlichen Umstände ändern. Im Artikel hatte das Paar einen Kündigungsausschluss bis Ende September 2019 vereinbart, was die vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses erschwerte.
Beispiel: Ein Mietvertrag mit einem Kündigungsausschluss von zwei Jahren bedeutet, dass weder Mieter noch Vermieter den Vertrag innerhalb dieser zwei Jahre mit der regulären Frist kündigen können.
Widerklage
Eine Widerklage ist eine eigene Klage, die der Beklagte im selben Gerichtsverfahren gegen den Kläger erhebt. Sie ist quasi eine „Gegenklage“ innerhalb des bereits bestehenden Rechtsstreits. Mit einer Widerklage kann der Beklagte eigene Ansprüche gegen den Kläger geltend machen, um diese im selben Verfahren klären zu lassen. Im vorliegenden Fall erhob der Beklagte eine Widerklage, um die Klägerin zur Mitwirkung an der Kündigung des Mietvertrags zu zwingen und andere Forderungen geltend zu machen.
Beispiel: Wenn eine Person auf Schadensersatz verklagt wird, kann sie im Gegenzug eine Widerklage einreichen und behaupten, dass sie selbst einen Schaden durch das Verhalten des Klägers erlitten hat.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 426 Abs. 1: Wenn mehrere Personen gemeinsam für eine Schuld haften (Gesamtschuldner sind) und einer von ihnen mehr als seinen internen Anteil zahlt, kann er von den anderen den Ausgleich des zu viel Gezahlten verlangen. Es geht um den internen Ausgleich unter den Schuldnern, nachdem sie gemeinsam gegenüber einem Dritten (z.B. Vermieter) gehaftet haben. Der Anspruch besteht, damit die Last der gemeinsamen Schuld fair unter den Schuldnern verteilt wird, entsprechend ihrer internen Vereinbarung.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Frau hatte die volle Miete gezahlt und damit auch den Anteil des Ex-Partners beglichen, wofür sie nach dieser Vorschrift einen Anspruch auf Erstattung gegen ihn hatte.
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 421: Sind mehrere Personen gemeinsam für dieselbe Leistung verantwortlich, so kann der Gläubiger (z.B. der Vermieter) die gesamte Leistung von jedem der Schuldner einzeln fordern. Dies bedeutet, der Gläubiger muss sich nicht aussuchen, wer wie viel zahlt; er kann sich den aussuchen, von dem er am ehesten das Geld bekommt. Sobald einer der Schuldner die gesamte Forderung beglichen hat, sind alle anderen ebenfalls von ihrer Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger befreit.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Mann und Frau waren als Mieter Gesamtschuldner gegenüber dem Vermieter. Der Vermieter konnte die gesamte Miete von der Frau verlangen, nachdem der Mann die Zahlungen eingestellt hatte, da beide voll hafteten.
- Grundsatz der Vertragstreue (Pacta sunt servanda) / Freiheit der Vertragsgestaltung: Dieser grundlegende Rechtsprinzip besagt, dass einmal wirksam geschlossene Verträge einzuhalten sind. Er betont die Verbindlichkeit von Vereinbarungen und die Freiheit der Vertragsparteien, innerhalb der gesetzlichen Grenzen ihre eigenen Bedingungen festzulegen. Verträge schaffen Recht zwischen den Parteien und können nicht einseitig ohne weiteres aufgehoben werden.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Paar hatte bewusst einen Mietvertrag mit einem langfristigen Kündigungsausschluss unterschrieben. Das Gericht betonte, dass diese gemeinsame und bewusste Bindung auch nach der Trennung fair berücksichtigt werden muss und die Zahlungspflicht bestehen bleibt.
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) / §§ 705 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Eine GbR entsteht, wenn sich mehrere Personen durch Vertrag zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks zusammenschließen. Eine solche Gesellschaft kann auch konkludent, also durch schlüssiges Handeln und ohne schriftlichen Vertrag, entstehen. Nichteheliche Lebensgemeinschaften werden rechtlich oft als GbR eingeordnet, wenn sie über das bloße Zusammenleben hinaus gemeinsame wirtschaftliche oder persönliche Ziele verfolgen. Nach Beendigung des Gesellschaftszwecks hat jeder Gesellschafter einen Anspruch auf Auseinandersetzung und Beendigung gemeinsamer Verpflichtungen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die nichteheliche Lebensgemeinschaft des Paares wurde als GbR qualifiziert. Nach der Trennung hatte der Beklagte daher einen Anspruch darauf, dass die Klägerin bei der Kündigung des Mietvertrags mitwirkt.
- Beweislast im Zivilprozess / Zivilprozessordnung (ZPO): Im Zivilprozess muss jede Partei die Tatsachen beweisen, die für ihre eigenen Ansprüche oder zur Abwehr von Forderungen relevant sind. Das Gericht entscheidet nach freier Überzeugung, ob eine Behauptung durch die vorgelegten Beweise als wahr anzusehen ist. Kann eine Partei die von ihr behaupteten, für den Erfolg ihrer Klage oder Verteidigung wesentlichen Tatsachen nicht beweisen, geht dies zu ihren Lasten.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Beklagte konnte seine Behauptung, eine Nebenkostennachzahlung geleistet zu haben, nicht beweisen. Daher wurde seine entsprechende Forderung vom Gericht abgewiesen, da er seine Beweispflicht nicht erfüllt hatte.
Das vorliegende Urteil
AG Hamburg-St. Georg – Az.: 911 C 245/17 – Urteil vom 13.09.2018
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.