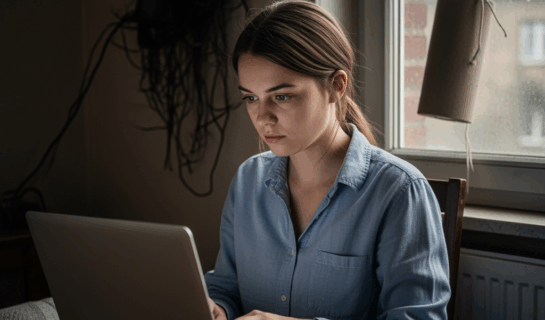Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Miete zu spät bezahlt – droht die Kündigung trotzdem?
- Was war genau der Auslöser für den Rechtsstreit?
- Warum haben die Vermieter gleich zwei Kündigungen ausgesprochen?
- Wie haben sich die Mieter gegen die Kündigung gewehrt?
- Warum wurde die fristlose Kündigung unwirksam, die normale Kündigung aber nicht?
- Weshalb hat das Gericht die Begründung der Mieter nicht gelten lassen?
- Hätten die Vermieter die Mieter nicht zuerst abmahnen müssen?
- Wie lautete also das endgültige Urteil des Gerichts?
- Die Schlüsselerkenntnisse
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wann ist eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen unwirksam, auch wenn ich alles nachzahle?
- Unter welchen Voraussetzungen kann mein Vermieter das Mietverhältnis ordentlich kündigen, wenn ich mit der Miete im Rückstand bin?
- Welche Rolle spielt es, ob ich den Mietrückstand selbst verschuldet habe oder nicht?
- Welche rechtlichen Schritte kann ich als Mieter unternehmen, wenn ich eine Kündigung wegen Mietrückstand erhalte?
- Was passiert, wenn ich nach einer ordentlichen Kündigung die Wohnung nicht fristgerecht räume?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 7 C 187/10 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: AG Remscheid
- Datum: 17.03.2011
- Aktenzeichen: 7 C 187/10
- Verfahren: Klageverfahren
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Die Eigentümer und Vermieter einer Wohnung und Doppelgarage, die wegen Mietrückständen die Kündigung aussprachen und auf Räumung klagten.
- Beklagte: Die Mieter der Wohnung und Doppelgarage, die mit der Miete in Rückstand gerieten, diese später aber nachzahlten und die Kündigung als unwirksam ansahen.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Die Mieter gerieten mit der Mietzahlung für zwei aufeinanderfolgende Monate in Rückstand. Daraufhin kündigten die Vermieter das Mietverhältnis fristlos und hilfsweise ordentlich. Obwohl die Mieter die gesamten Rückstände vor Klagezustellung beglichen, hielten die Vermieter an der hilfsweise erklärten ordentlichen Kündigung fest und klagten auf Räumung.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Ist ein Mietverhältnis, das wegen eines erheblichen Mietrückstands fristlos und hilfsweise ordentlich gekündigt wurde, wirksam beendet, obwohl der Mieter die Rückstände später innerhalb der Schonfrist nachgezahlt hat, und ist der Mieter zur Räumung verpflichtet?
Wie hat das Gericht entschieden?
- Klage auf Räumung stattgegeben: Die Beklagten wurden verurteilt, die Mietobjekte zum 30.04.2011 zu räumen und an die Kläger herauszugeben.
- Kernaussagen der Begründung:
- Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung: Die hilfsweise erklärte Ordentliche Kündigung war wirksam, da der Zahlungsverzug eine erhebliche Pflichtverletzung der Mieter darstellte.
- Keine Heilung der ordentlichen Kündigung: Die gesetzliche „Schonfrist“ (§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB), die eine Fristlose Kündigung bei Nachzahlung unwirksam macht, erstreckt sich nicht auf eine gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung.
- Keine Abmahnung nötig: Bei einem so erheblichen Zahlungsverzug, der sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen würde, war eine vorherige Abmahnung durch die Vermieter nicht erforderlich.
- Verschulden der Mieter bejaht: Die von den Mietern vorgebrachten Gründe für den Zahlungsverzug (Geldtransfer aus Mexiko) waren nicht schlüssig dargelegt, sodass ein Verschulden angenommen wurde.
- Folgen für die Klägerin/den Kläger:
- Die Kläger erhalten die Räumung der Wohnung und Doppelgarage durch die Beklagten.
- Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
Der Fall vor Gericht
Miete zu spät bezahlt – droht die Kündigung trotzdem?
Stellen Sie sich vor, Sie sind Mieter und geraten aus unvorhergesehenen Gründen in finanzielle Schwierigkeiten. Sie können zwei Monatsmieten nicht pünktlich bezahlen. Ihr Vermieter zögert nicht lange und schickt Ihnen die Kündigung. In Panik schaffen Sie es, das Geld aufzutreiben und überweisen die gesamte ausstehende Summe. Puh, alles wieder gut, denken Sie? Ein Urteil des Amtsgerichts Remscheid zeigt, dass die Situation komplizierter sein kann. Das Gericht musste klären, ob ein Mietverhältnis wirklich beendet ist, obwohl der Mieter seine Schulden nachträglich beglichen hat.
Was war genau der Auslöser für den Rechtsstreit?

In diesem Fall ging es um ein Mietverhältnis für eine Wohnung mit Doppelgarage in Remscheid. Die Mieter, ein Ehepaar, hatten die Wohnung seit September 2004 gemietet. Die monatliche Miete inklusive Nebenkosten betrug zuletzt 875,00 Euro und musste, wie in den meisten Mietverträgen üblich, im Voraus bis zum dritten Werktag des Monats bezahlt werden.
Im Herbst 2010 kam es zu Problemen: Die Mieten für die Monate September und Oktober 2010 wurden nicht bezahlt. Der Vermieter reagierte prompt. Mit einem Schreiben vom 19. Oktober 2010 kündigte er den Mietern. Doch wie konnte es dazu kommen und wie ging es weiter? Am 5. November 2010 bezahlten die Mieter zwar die rückständigen Mieten für September und Oktober. Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits die Novembermiete fällig und ebenfalls noch nicht bezahlt. Die Vermieter reichten daraufhin am 16. November 2010 eine Räumungsklage bei Gericht ein. Das bedeutet, sie verklagten die Mieter darauf, die Wohnung zu verlassen. Kurz darauf, am 23. November 2010, bezahlten die Mieter auch die Mieten für November und Dezember.
Warum haben die Vermieter gleich zwei Kündigungen ausgesprochen?
Dies ist ein entscheidender Punkt, um das Urteil zu verstehen. Die Vermieter sprachen nicht nur eine, sondern zwei Kündigungen in einem einzigen Schreiben aus. Das ist eine übliche Vorgehensweise, um sich rechtlich abzusichern.
- Die fristlose Kündigung: Diese beendet das Mietverhältnis sofort. Sie ist aber nur bei sehr schweren Vertragsverstößen möglich, wie zum Beispiel einem erheblichen Mietrückstand. Wenn ein Mieter für zwei aufeinanderfolgende Monate die Miete nicht zahlt, ist das ein solcher schwerer Verstoß.
- Die hilfsweise ordentliche Kündigung: „Hilfsweise“ bedeutet hier so viel wie „als Plan B“. Die Vermieter sagten damit quasi: „Wir kündigen euch fristlos. Sollte ein Gericht diese fristlose Kündigung aber aus irgendeinem Grund für unwirksam halten, kündigen wir euch ersatzweise mit der gesetzlichen Kündigungsfrist.“ Die ordentliche Kündigung beendet das Mietverhältnis nicht sofort, sondern erst nach Ablauf einer bestimmten Frist, die von der Dauer des Mietverhältnisses abhängt.
Dieser juristische Kniff sollte im weiteren Verlauf des Verfahrens eine zentrale Rolle spielen.
Wie haben sich die Mieter gegen die Kündigung gewehrt?
Die Mieter wollten die Kündigung nicht akzeptieren und baten das Gericht, die Klage abzuweisen. Ihre Begründung: Der Zahlungsverzug sei unverschuldet gewesen. „Unverschuldet“ bedeutet im juristischen Sinne, dass sie keine Schuld daran trifft, dass sie ihre Pflichten nicht erfüllen konnten.
Die Mieterin erklärte, sie sei zu der Zeit in Mexiko gewesen, um ihren dort lebenden Mann zu besuchen. Sie habe von dort aus versucht, Geld nach Deutschland zu überweisen, um die Miete zu bezahlen. Dabei sei sie auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen. Ihre Bank habe ihr gesagt, sie könne kein Geld einzahlen, weil sie kein Konto bei der Partnerbank in Mexiko habe und auch keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis für das Land besitze. Zusätzlich habe ein Verkehrsunfall ihre geplante Rückkehr nach Deutschland verzögert. Trotzdem habe sie es schließlich geschafft, die Schulden über einen Geldtransferdienst zu begleichen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland habe sie sofort die restlichen Mieten überwiesen. Ihr Argument war also: Da wir nichts für die Verzögerung konnten und alles nachgezahlt haben, ist die Kündigung unwirksam.
Warum wurde die fristlose Kündigung unwirksam, die normale Kündigung aber nicht?
Hier liegt der juristische Kern des Falles. Das Gericht musste zwei getrennte Fragen beantworten. Zuerst zur fristlosen Kündigung: Das Gesetz bietet Mietern bei einer fristlosen Kündigung wegen Zahlungsverzugs einen besonderen Schutz, die sogenannte Schonfristzahlung (§ 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB). Man könnte es als eine Art „letzte Chance“ bezeichnen. Diese Regel besagt: Zahlt der Mieter alle rückständigen Mieten bis spätestens zwei Monate, nachdem er die Räumungsklage vom Gericht erhalten hat, wird die fristlose Kündigung unwirksam. Sie wird sozusagen „geheilt“.
Genau das ist hier passiert. Die Mieter hatten alle Rückstände bezahlt. Daher war die fristlose Kündigung vom Tisch. Die Vermieter erkannten das selbst an und zogen ihren Antrag auf sofortige Räumung zurück.
Aber was ist mit der zweiten Kündigung, der „Plan B“-Kündigung? Das Gericht stellte klar: Diese Rettungsregel der Schonfristzahlung gilt ausschließlich für die fristlose Kündigung. Sie heilt nicht die gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung. Die Logik des Gerichts war dabei wie folgt:
- Ein Mietrückstand von zwei Monatsmieten ist eine erhebliche Verletzung der Vertragspflichten des Mieters.
- Eine solch erhebliche Pflichtverletzung gibt dem Vermieter ein Berechtigtes Interesse (§ 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB), das Mietverhältnis zu beenden. Das ist die Voraussetzung für eine wirksame ordentliche Kündigung.
- Die nachträgliche Zahlung macht die ursprüngliche, schwere Pflichtverletzung nicht ungeschehen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter ist durch den Verzug bereits nachhaltig gestört.
Die ordentliche Kündigung blieb also trotz der Nachzahlung wirksam.
Weshalb hat das Gericht die Begründung der Mieter nicht gelten lassen?
Die Mieter hatten ja argumentiert, sie treffe keine Schuld am Zahlungsverzug. Doch auch hier folgte das Gericht ihnen nicht. Im Zivilrecht gilt: Wer sich auf besondere Umstände beruft, die ihn entlasten sollen, muss diese auch überzeugend darlegen und beweisen. Man nennt das die Darlegungs- und Beweislast.
Das Gericht fand die Geschichte der Mieter nicht überzeugend. Es kritisierte, dass die Mieter nicht schlüssig erklärt hatten, warum der Geldtransfer ausgerechnet auf diesem komplizierten Weg von Mexiko aus erfolgen musste. Sie hätten nicht dargelegt, woher das Geld überhaupt stammte und warum es nicht beispielsweise von einem deutschen Konto oder auf einem anderen, einfacheren Weg hätte bezahlt werden können. Das Gericht merkte an, dass der Ehemann schon länger in Mexiko lebte und es unwahrscheinlich sei, dass er noch nie zuvor Geld nach Deutschland überwiesen hatte. Die Erklärung wirkte lückenhaft. Da die grundsätzliche Notwendigkeit für diesen speziellen, riskanten Geldtransfer nicht nachvollziehbar war, spielte es für das Gericht auch keine Rolle mehr, ob die weiteren Details über den Unfall oder die Bankprobleme stimmten. Das Gericht ging daher davon aus, dass die Mieter den Zahlungsverzug zu verschulden hatten.
Hätten die Vermieter die Mieter nicht zuerst abmahnen müssen?
Normalerweise muss ein Vermieter einen Mieter bei Vertragsverstößen zunächst abmahnen, also ihm eine offizielle Warnung geben, bevor er kündigen kann. Eine Abmahnung soll dem Mieter die Chance geben, sein Verhalten zu ändern.
Das Gericht entschied jedoch, dass eine Abmahnung in diesem Fall nicht notwendig war. Die Begründung ist einfach: Der Rückstand mit zwei kompletten Monatsmieten ist eine so schwerwiegende Pflichtverletzung, dass sie laut Gesetz sogar eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung rechtfertigt. Wenn aber schon der „schärfste Schuss“ – die fristlose Kündigung – ohne Warnung erlaubt ist, dann muss das erst recht für den „milderen Schuss“ – die ordentliche Kündigung aus demselben Grund – gelten. Die Schwere des Verstoßes machte eine Warnung überflüssig.
Wie lautete also das endgültige Urteil des Gerichts?
Das Amtsgericht Remscheid verurteilte die Mieter, die Wohnung und die Garage zum 30. April 2011 zu räumen und an die Vermieter zu übergeben. Da die ordentliche Kündigung vom 19. Oktober 2010 wirksam war, endete das Mietverhältnis nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist.
Zusätzlich wurden die Mieter dazu verurteilt, die Kosten des gesamten Rechtsstreits zu tragen. Das Urteil wurde für Vorläufig vollstreckbar erklärt. Das bedeutet, die Vermieter könnten die Räumung durch einen Gerichtsvollzieher durchsetzen lassen, selbst wenn die Mieter noch Rechtsmittel einlegen, also gegen das Urteil vorgehen würden. Die Mieter erhielten aber die Möglichkeit, diese sofortige Zwangsvollstreckung durch die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2.625,00 Euro abzuwenden.
Auf Antrag der Mieter gewährte das Gericht ihnen jedoch eine Räumungsfrist bis zum 31. Mai 2011. Diese Frist soll Mietern die Möglichkeit geben, in Ruhe eine neue Wohnung zu suchen und den Umzug zu organisieren.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil des Amtsgerichts Remscheid zeigt die wichtige Unterscheidung zwischen verschiedenen Kündigungsarten bei Mietrückständen und verdeutlicht, dass nachträgliche Zahlungen nicht alle rechtlichen Konsequenzen beseitigen.
- Schonfristzahlung heilt nur fristlose Kündigungen: Die gesetzliche Regelung der Schonfristzahlung nach § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB macht ausschließlich fristlose Kündigungen unwirksam, wenn der Mieter alle Rückstände binnen zwei Monaten nach Erhalt der Räumungsklage begleicht – eine parallel ausgesprochene ordentliche Kündigung bleibt davon unberührt.
- Erhebliche Pflichtverletzungen rechtfertigen ordentliche Kündigungen dauerhaft: Das Gericht stellte fest, dass ein Mietrückstand von zwei Monatsmieten eine so schwerwiegende Vertragsverletzung darstellt, dass dem Vermieter ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses zusteht – diese ursprüngliche Pflichtverletzung wird durch nachträgliche Zahlung nicht ungeschehen gemacht.
- Unverschuldeter Zahlungsverzug erfordert schlüssige Darlegung: Mieter, die sich auf einen unverschuldeten Zahlungsverzug berufen, müssen die besonderen Umstände lückenlos und überzeugend darlegen – vage oder unplausible Erklärungen genügen den gerichtlichen Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast nicht.
Diese Entscheidung etabliert das Prinzip, dass Vermieter durch eine kombinierte Kündigungsstrategie effektiv gegen Mietrückstände vorgehen können, selbst wenn Mieter später ihre Schulden begleichen.
Befinden Sie sich in einer ähnlichen Situation? Fragen Sie unsere Ersteinschätzung an.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann ist eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen unwirksam, auch wenn ich alles nachzahle?
Eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen kann in Deutschland unwirksam werden, wenn die Mietschulden vollständig beglichen werden – dies ist die sogenannte „Schonfristzahlung“. Dieser Schutzmechanismus ist eine wichtige gesetzliche Regelung im Mietrecht.
Die „Schonfrist“ für die Nachzahlung
Damit die fristlose Kündigung unwirksam wird, müssen die gesamten Mietrückstände, die zur Kündigung geführt haben, innerhalb einer bestimmten Frist vollständig bezahlt werden. Diese Frist beträgt zwei Monate.
Der Startpunkt dieser Zwei-Monats-Frist ist entscheidend:
- Die Frist beginnt, sobald dem Mieter die Räumungsklage des Vermieters wegen der Mietrückstände zugestellt wurde. Das bedeutet, wenn Sie die Klageschrift vom Gericht erhalten, haben Sie ab diesem Zeitpunkt zwei Monate Zeit.
- Alternativ kann die fristlose Kündigung auch unwirksam werden, wenn die Nachzahlung innerhalb von zwei Monaten nach Ausspruch der Kündigung erfolgt und der Vermieter bis dahin noch keine Räumungsklage eingereicht hat. Dies ist jedoch seltener der Fall, da Vermieter bei Nichtzahlung meist zügig Klage erheben.
Wer kann zahlen und was geschieht dann?
Es ist nicht nur der Mieter selbst, der die Zahlung leisten kann. Auch ein öffentlicher Träger (wie zum Beispiel das Jobcenter oder das Sozialamt) kann die vollständigen Mietrückstände innerhalb dieser Schonfrist begleichen.
Wird die Zahlung fristgerecht und vollständig geleistet, wird die fristlose Kündigung rückwirkend unwirksam. Sie wird so behandelt, als wäre sie nie ausgesprochen worden. Für Sie als Mieter bedeutet das, dass der Hauptgrund für die fristlose Kündigung – die Mietrückstände – beseitigt ist und Sie Ihr Mietverhältnis fortsetzen können.
Wichtige Einschränkung dieses Schutzes
Dieser besondere Schutzmechanismus der Schonfristzahlung ist jedoch nicht unbegrenzt nutzbar. Er gilt in der Regel nur einmal innerhalb von zwei Jahren. Das bedeutet: Wenn Sie bereits innerhalb der letzten zwei Jahre eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen durch eine Schonfristzahlung abwenden konnten, dann steht Ihnen dieser Schutz für eine erneute fristlose Kündigung wegen neuer Mietrückstände innerhalb dieses Zeitraums grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung.
Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass die Schonfristzahlung nur die fristlose Kündigung wegen Mietrückständen unwirksam macht. Hat der Vermieter gleichzeitig eine ordentliche Kündigung ausgesprochen – die auf anderen Gründen oder denselben Mietrückständen basiert, aber mit längerer Frist – dann bleibt diese ordentliche Kündigung bestehen und muss gesondert geprüft werden.
Unter welchen Voraussetzungen kann mein Vermieter das Mietverhältnis ordentlich kündigen, wenn ich mit der Miete im Rückstand bin?
Ein Mietverhältnis kann vom Vermieter nur dann ordentlich, also mit gesetzlicher Kündigungsfrist, beendet werden, wenn er hierfür ein berechtigtes Interesse hat. Dieses berechtigte Interesse muss im Kündigungsschreiben konkret benannt werden. Im Falle von Mietrückständen oder unpünktlichen Mietzahlungen kann ein solches berechtigtes Interesse vorliegen.
Berechtigtes Interesse bei Mietrückständen und unpünktlichen Zahlungen
Die pünktliche Zahlung der Miete ist eine der Hauptpflichten eines Mieters. Wenn diese Pflicht erheblich oder wiederholt verletzt wird, kann dies ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses begründen.
Hierbei geht es nicht nur um die akute Situation eines hohen Rückstands, der eventuell zu einer fristlosen Kündigung führen könnte. Auch wenn Sie einen Mietrückstand später ausgleichen und damit möglicherweise eine fristlose Kündigung unwirksam wird, bleibt die Tatsache des Rückstands oder einer unpünktlichen Zahlung bestehen. Für das Gericht ist entscheidend, ob das Vertrauensverhältnis zwischen Vermieter und Mieter durch die Verletzung der Zahlungspflicht nachhaltig gestört ist.
Ein berechtigtes Interesse für eine ordentliche Kündigung kann beispielsweise vorliegen bei:
- Erheblichem und wiederholtem Zahlungsverzug: Wenn die Miete regelmäßig unpünktlich oder nur nach Mahnung gezahlt wird, selbst wenn die Rückstände später ausgeglichen werden.
- Größeren Mietrückständen: Auch wenn ein einmaliger größerer Mietrückstand schnell beglichen wird, kann der Vermieter argumentieren, dass das Vertrauen durch die Schwere des Vorfalls so stark beeinträchtigt wurde, dass ein Festhalten am Mietverhältnis für ihn unzumutbar ist.
Der Gesetzgeber sieht in einem schuldhaften und erheblichen Verstoß gegen die vertraglichen Pflichten des Mieters (wie die pünktliche Mietzahlung) einen wichtigen Grund für eine ordentliche Kündigung (§ 573 Abs. 2 Nr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).
Unterschied zur fristlosen Kündigung und ihre Auswirkungen
Es ist wichtig, den Unterschied zur fristlosen Kündigung zu verstehen. Eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist an sehr strenge Voraussetzungen geknüpft (z.B. zwei aufeinanderfolgende Monatsmieten im Rückstand) und kann unter Umständen geheilt werden, wenn der Mieter die vollständigen Rückstände innerhalb kurzer Zeit nach Erhalt der Kündigung oder Klagezahlung ausgleicht.
Diese „Heilung“ der fristlosen Kündigung bedeutet jedoch nur, dass das Mietverhältnis nicht sofort beendet wird. Sie hat keine Auswirkung darauf, ob der ursprüngliche Zahlungsverzug oder die unpünktliche Zahlung als berechtigtes Interesse für eine ordentliche Kündigung dienen kann.
Praktische Auswirkungen:
Für Sie bedeutet dies, dass selbst wenn Sie eine fristlose Kündigung durch Nachzahlung abwenden konnten, das zugrunde liegende Fehlverhalten – der Zahlungsverzug – weiterhin als Grund für eine ordentliche Kündigung mit gesetzlicher Frist herangezogen werden kann. Das Mietverhältnis wird dann nicht von heute auf morgen beendet, aber es endet nach Ablauf der Kündigungsfrist. Dies verdeutlicht, dass die Zuverlässigkeit bei der Mietzahlung ein entscheidender Faktor für die langfristige Stabilität eines Mietverhältnisses ist. Wiederholte Probleme können das Vertrauen so stark schädigen, dass der Vermieter berechtigt ist, das Mietverhältnis auch auf diesem Weg zu beenden.
Welche Rolle spielt es, ob ich den Mietrückstand selbst verschuldet habe oder nicht?
Für die Frage, ob ein Mietrückstand vorliegt und welche rechtlichen Konsequenzen dieser haben kann, ist es grundsätzlich unerheblich, ob Sie den Rückstand selbst verschuldet haben. Im deutschen Mietrecht steht die pünktliche und vollständige Zahlung der Miete als Hauptpflicht des Mieters im Vordergrund. Der Vermieter hat einen Anspruch auf die Miete, und wenn diese nicht oder nicht vollständig gezahlt wird, entsteht ein Mietrückstand.
Die strikte Zahlungspflicht und ihre Folgen
Das Gesetz sieht vor, dass ein Mietrückstand von einer bestimmten Höhe oder Dauer zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter berechtigen kann. Hierbei kommt es vorrangig auf die reine Tatsache des Zahlungsverzugs an, nicht auf dessen Ursache. Ob Sie beispielsweise aufgrund einer plötzlichen Arbeitslosigkeit, einer schweren Krankheit oder einfach wegen schlechter Finanzplanung nicht zahlen konnten, ändert nichts daran, dass ein Mietrückstand besteht.
Für Sie bedeutet das: Die Zahlungspflicht ist sehr streng. Gerichte prüfen in der Regel, ob die Voraussetzungen für einen Mietrückstand (z.B. zwei aufeinanderfolgende Monatsmieten oder ein Betrag, der diese Höhe übersteigt) erfüllt sind. Ist dies der Fall, kann eine Kündigung wirksam sein.
Wann das Verschulden eine sehr geringe Rolle spielen kann
Mieter denken oft, ein unverschuldeter Engpass könnte sie vor den Folgen schützen. Dies ist jedoch nur in sehr seltenen und eng umgrenzten Ausnahmefällen der Fall und ändert nie die Pflicht zur Nachzahlung der Miete.
Wenn überhaupt, kann die Frage des Verschuldens bei einer Härtefallprüfung in einem späteren Räumungsprozess eine untergeordnete Rolle spielen. Hierbei geht es darum, ob die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter eine außergewöhnliche, unzumutbare Härte darstellen würde. Selbst dann würde in der Regel kein Schuldenerlass erfolgen, sondern allenfalls ein Aufschub der Räumung. Die Miete bleibt stets geschuldet und muss nachgezahlt werden. Ein solcher Härtefall ist jedoch extrem schwer darzulegen und zu beweisen und wird von Gerichten nur in Ausnahmefällen anerkannt.
Hohe Anforderungen an den Beweis unverschuldeter Zahlungsunfähigkeit
Wenn Sie sich auf einen unverschuldeten Engpass berufen wollen, um überhaupt eine Chance auf eine – wenn auch geringe – Berücksichtigung zu haben, müssen Sie dies sehr detailliert darlegen und zweifelsfrei beweisen. Bloße Behauptungen, Sie hätten „Pech gehabt“ oder „unerwartete Ausgaben“ gehabt, reichen hierfür nicht aus.
Gerichte erwarten in der Regel objektive und nachvollziehbare Nachweise, die den unverschuldeten und unvorhersehbaren Charakter des Engpasses belegen. Dazu gehören beispielsweise:
- Nachweise über einen plötzlichen, unverschuldeten Arbeitsplatzverlust: Dies können Kündigungsschreiben, Bescheide über Arbeitslosengeld oder ähnliche offizielle Dokumente sein.
- Ärztliche Atteste über eine schwere, plötzlich aufgetretene Krankheit, die zu einer erheblichen und nicht erwarteten Einkommenseinbuße geführt hat (z.B. durch längeren Krankenhausaufenthalt oder Bezug von Krankengeld).
- Beweise für unvorhersehbare Katastrophen oder Unglücksfälle, die Ihre finanzielle Situation unverschuldet massiv beeinträchtigt haben (z.B. durch Naturereignisse oder Unfälle mit hohen Folgekosten, die nicht durch Versicherungen abgedeckt waren).
Wichtig ist, dass diese Umstände nicht vorhersehbar waren und Sie alles Zumutbare getan haben, um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Der Fokus liegt stets darauf, ob die Miete dennoch hätte gezahlt werden können oder müssen. Eine schlechte Finanzplanung, unüberlegte Ausgaben oder das Verpassen von Fristen für Sozialleistungen werden in der Regel nicht als „unverschuldet“ anerkannt. Die Beweislast liegt vollkommen bei Ihnen.
Welche rechtlichen Schritte kann ich als Mieter unternehmen, wenn ich eine Kündigung wegen Mietrückstand erhalte?
Eine Kündigung wegen Mietrückstands ist für Mieter eine ernsthafte Situation, die jedoch gesetzliche Regelungen und bestimmte Handlungsmöglichkeiten umfasst. Es ist wichtig, die Abläufe und Fristen zu verstehen, die das Mietrecht in Deutschland vorsieht.
Kontaktaufnahme und Kommunikation
Ein erster Schritt kann die Kontaktaufnahme mit dem Vermieter sein. Manchmal lassen sich Missverständnisse klären oder Zahlungsmodalitäten besprechen, um eine schnelle Lösung zu finden und die Situation zu entschärfen. Offene Kommunikation kann dazu beitragen, weitere Eskalationen zu vermeiden, ist aber keine rechtliche Verpflichtung und ersetzt nicht die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.
Prüfung der Kündigung
Eine Kündigung wegen Mietrückstands muss bestimmte formale Anforderungen erfüllen, um wirksam zu sein.
- Schriftform: Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und vom Vermieter oder dessen bevollmächtigtem Vertreter eigenhändig unterschrieben sein. Eine E-Mail oder SMS genügt nicht.
- Kündigungsgrund: Die Kündigung muss den genauen Grund klar benennen, also den Mietrückstand detailliert aufschlüsseln (welche Monate, welche Beträge). Fehlt eine Begründung oder ist sie unzureichend, kann die Kündigung unwirksam sein.
- Erheblicher Mietrückstand: Eine fristlose Kündigung ist in der Regel nur zulässig, wenn ein erheblicher Mietrückstand vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Mieter an zwei aufeinanderfolgenden Terminen mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit einem Betrag in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Für Sie bedeutet das, dass das Schreiben des Vermieters daraufhin überprüft werden kann, ob alle notwendigen Angaben enthalten sind und die Form gewahrt wurde.
Die Schonfrist zur Rettung des Mietverhältnisses
Ein zentraler Punkt im deutschen Mietrecht ist die sogenannte Schonfrist. Wenn eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs (Mietrückstand) ausgesprochen wurde, kann der Mieter die Kündigung unwirksam machen, indem er die gesamten fälligen Mietrückstände vollständig begleicht.
- Frist: Die Nachzahlung muss innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Kündigung erfolgen. Das bedeutet, dass der gesamte fällige Betrag innerhalb dieser Frist beim Vermieter eingegangen sein muss.
- Zahlung durch Dritte: Die Zahlung kann nicht nur durch den Mieter selbst erfolgen, sondern auch durch eine öffentliche Stelle (z.B. das Sozialamt), sofern diese die Übernahme der Mietschulden erklärt.
- Einmalige Möglichkeit: Diese Möglichkeit, die Kündigung durch Nachzahlung unwirksam zu machen, besteht nur einmal innerhalb von zwei Jahren. Hat der Mieter bereits innerhalb der letzten zwei Jahre eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch Nachzahlung unwirksam gemacht, so greift die Schonfrist bei einer erneuten Kündigung nicht mehr.
Die praktische Auswirkung dieser Regelung ist, dass bei einer fristlosen Kündigung wegen Mietrückstands die unmittelbare Gefahr eines Wohnungsverlusts abgewendet werden kann, wenn die Mietschulden innerhalb der gesetzlich festgelegten zwei Monate vollständig beglichen werden. Begleicht der Mieter die Rückstände innerhalb der Schonfrist, wird die Kündigung unwirksam, und das Mietverhältnis besteht fort. Wird die Kündigung nicht durch Nachzahlung unwirksam oder ist sie aus anderen Gründen wirksam, kann der Vermieter im nächsten Schritt eine Räumungsklage einreichen.
Was passiert, wenn ich nach einer ordentlichen Kündigung die Wohnung nicht fristgerecht räume?
Wenn Ihre Mietwohnung ordentlich und wirksam gekündigt wurde, aber Sie die Wohnung zum Ende der Kündigungsfrist nicht verlassen, leitet der Vermieter in der Regel rechtliche Schritte ein, um die Räumung durchzusetzen. Dies führt meist zu einer Räumungsklage vor Gericht.
Der Weg zur Räumungsklage
Der Vermieter wird das zuständige Gericht (Amtsgericht) anrufen und eine Klage auf Räumung und Herausgabe der Wohnung einreichen. Ziel dieser Klage ist es, einen sogenannten Räumungstitel zu erhalten. Dieser Titel ist ein gerichtliches Urteil oder ein anderer vollstreckbarer Beschluss, der den Vermieter berechtigt, die Zwangsräumung der Wohnung durchzuführen. Ohne einen solchen Titel kann ein Vermieter niemanden aus einer Wohnung entfernen. Das Gericht prüft, ob die Kündigung wirksam war. Wenn das Gericht die Kündigung als rechtmäßig ansieht und feststellt, dass die Wohnung geräumt werden muss, erlässt es ein Räumungsurteil.
Das Räumungsurteil und die Räumungsfrist
Ein solches Urteil spricht aus, dass Sie die Wohnung räumen und an den Vermieter herausgeben müssen. Das Gericht kann in diesem Urteil eine Räumungsfrist gewähren. Dies ist eine zusätzliche, oft kurze, vom Gericht bestimmte Zeitspanne, innerhalb derer Sie die Wohnung noch freiwillig verlassen können, bevor die eigentliche Zwangsvollstreckung beginnt. Diese Frist wird meist gewährt, um Ihnen die Suche nach neuem Wohnraum zu erleichtern oder einen Umzug zu organisieren. Sie ist jedoch keine Pflicht, sondern liegt im Ermessen des Gerichts, und sie ist in der Regel nicht sehr lang.
Ein wichtiger Aspekt des Räumungsurteils ist die vorläufige Vollstreckbarkeit. Dies bedeutet, dass der Vermieter das Urteil in den meisten Fällen sofort vollstrecken lassen kann, auch wenn Sie gegen das Urteil Berufung einlegen oder andere Rechtsmittel einlegen möchten. Das heißt, der Vermieter muss nicht warten, bis ein höheres Gericht endgültig entschieden hat. Für Sie bedeutet das: Selbst wenn Sie mit dem Urteil nicht einverstanden sind und Rechtsmittel einlegen, kann die Räumung bereits stattfinden.
Die Rolle des Gerichtsvollziehers und die Zwangsvollstreckung
Wenn das Räumungsurteil ergangen ist und gegebenenfalls die Räumungsfrist abgelaufen ist, kann der Vermieter einen Gerichtsvollzieher beauftragen. Der Gerichtsvollzieher ist eine staatliche Amtsperson, die für die Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen zuständig ist. Er kündigt Ihnen die Zwangsräumung mit einer angemessenen Frist an und setzt einen konkreten Termin für die Räumung fest. Zum angesetzten Termin erscheint der Gerichtsvollzieher, um die Wohnung zwangsweise zu räumen. Das kann bedeuten, dass Schlösser ausgetauscht werden und Ihre persönlichen Gegenstände aus der Wohnung entfernt werden. Ihre Sachen werden dann entweder eingelagert oder, wenn sie keinen Wert mehr haben, entsorgt.
Die damit verbundenen Kosten
Die Zwangsräumung ist für Sie als Mieterin oder Mieter, die nicht fristgerecht räumt, mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden. Grundsätzlich trägt die unterliegende Partei im Rechtsstreit die Kosten. Das bedeutet:
- Gerichtskosten: Die Gebühren für das Gericht.
- Anwaltskosten: Die Kosten des Anwalts des Vermieters.
- Gerichtsvollzieherkosten: Die Gebühren für die Beauftragung des Gerichtsvollziehers.
- Räumungskosten: Dies sind die Kosten für das Ausräumen der Wohnung, den Transport und die Einlagerung Ihrer Möbel und Gegenstände oder deren Entsorgung. Diese Kosten können sehr hoch sein, da oft ein Umzugsunternehmen beauftragt wird.
- Nutzungsentschädigung: Solange Sie die Wohnung nach Ablauf der Kündigungsfrist weiter nutzen, sind Sie verpflichtet, dem Vermieter eine sogenannte Nutzungsentschädigung zu zahlen. Diese entspricht in der Regel der bisherigen Miete, kann aber unter Umständen auch höher ausfallen, wenn dem Vermieter ein größerer Schaden entstanden ist.
Die Summe dieser Kosten kann schnell mehrere Tausend Euro erreichen und stellt eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Darüber hinaus kann eine Zwangsräumung auch die Suche nach neuem Wohnraum erschweren, da Vermieter oft Nachweise über die Ordnungsmäßigkeit früherer Mietverhältnisse verlangen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Abmahnung
Eine Abmahnung ist eine offizielle schriftliche Rüge oder Warnung des Vermieters an den Mieter wegen eines Vertragsverstoßes. Ihr Zweck ist es, dem Mieter die Möglichkeit zu geben, sein vertragswidriges Verhalten zu ändern und so eine Kündigung abzuwenden. Bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen, wie einem erheblichen Mietrückstand, ist eine Abmahnung vor einer Kündigung in der Regel nicht erforderlich, da der Verstoß so gravierend ist, dass keine Vorwarnung nötig ist. Sie soll das Vertrauensverhältnis wiederherstellen oder vor einer Kündigung warnen.
Berechtigtes Interesse
Ein berechtigtes Interesse ist eine vom Gesetz geforderte Voraussetzung, die ein Vermieter haben muss, um ein Mietverhältnis ordentlich, also mit Frist, kündigen zu können. Es bedeutet, dass der Vermieter einen triftigen und nachvollziehbaren Grund für die Kündigung vorweisen muss. Häufige Gründe sind zum Beispiel Eigenbedarf, Hinderung an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks oder, wie im vorliegenden Fall, eine erhebliche schuldhafte Vertragsverletzung durch den Mieter. Ohne ein solches berechtigtes Interesse ist eine ordentliche Kündigung des Mietvertrags nicht wirksam.
Darlegungs- und Beweislast
Die Darlegungs- und Beweislast bestimmt im Zivilprozess, welche Partei welche Tatsachen behaupten und beweisen muss, damit das Gericht sie bei seiner Entscheidung berücksichtigt. Wer sich auf eine für ihn günstige Tatsache beruft, muss diese in der Regel selbst dem Gericht gegenüber schlüssig vortragen (darlegen) und gegebenenfalls beweisen. Kann eine Partei die von ihr behaupteten Tatsachen nicht beweisen, geht das Gericht davon aus, dass diese Tatsachen nicht existieren. Im Mietrecht bedeutet dies oft, dass der Mieter, der sich auf Unverschulden beruft, dieses auch nachvollziehbar beweisen muss.
Beispiel: Wenn der Mieter behauptet, er konnte die Miete aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht zahlen, muss er diese Umstände detailliert schildern und Belege dafür vorlegen, sonst wird sein Argument vom Gericht nicht berücksichtigt.
Fristlose Kündigung
Die fristlose Kündigung beendet ein Mietverhältnis mit sofortiger Wirkung, also ohne Einhaltung einer gesetzlichen Frist. Sie ist nur bei sehr schwerwiegenden Vertragsverletzungen zulässig, die dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf einer ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar machen. Ein klassisches Beispiel ist ein erheblicher Mietrückstand, etwa wenn der Mieter mit zwei Monatsmieten in Verzug ist. Ihr Ziel ist die schnelle Beendigung des Mietverhältnisses bei gravierendem Fehlverhalten.
Ordentliche Kündigung
Die ordentliche Kündigung beendet ein Mietverhältnis nicht sofort, sondern erst nach Ablauf einer gesetzlichen Kündigungsfrist. Diese Frist richtet sich in der Regel nach der Dauer des Mietverhältnisses. Im Gegensatz zur fristlosen Kündigung muss für eine ordentliche Kündigung immer ein berechtigtes Interesse des Vermieters vorliegen, das im Kündigungsschreiben begründet werden muss. Auch ein erheblicher Mietrückstand oder wiederholte unpünktliche Zahlungen können ein solches berechtigtes Interesse begründen. Sie beendet das Mietverhältnis mit einer festen Vorlaufzeit, basierend auf einem triftigen Grund.
Schonfristzahlung
Die Schonfristzahlung ist eine gesetzliche Regelung im Mietrecht, die Mietern eine „zweite Chance“ gibt, eine fristlose Kündigung wegen Mietrückständen abzuwenden. Zahlt der Mieter die gesamten rückständigen Mieten innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Räumungsklage, wird die zuvor ausgesprochene fristlose Kündigung unwirksam. Dies gilt auch, wenn ein öffentlicher Träger die Zahlung leistet. Diese Nachzahlung heilt ausschließlich die fristlose Kündigung, nicht aber eine gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung.
Beispiel: Erhält ein Mieter eine fristlose Kündigung wegen zwei ausstehender Monatsmieten und zahlt diese innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Räumungsklage, ist die fristlose Kündigung hinfällig.
Vorläufig vollstreckbar
Ein Urteil, das für vorläufig vollstreckbar erklärt wird, kann vom Gläubiger (im vorliegenden Fall dem Vermieter) unmittelbar nach der Urteilsverkündung durchgesetzt werden. Der Schuldner (hier die Mieter) kann sich dann nicht darauf berufen, dass er noch Rechtsmittel (wie eine Berufung) einlegen möchte, um die Vollstreckung aufzuhalten. Um die sofortige Vollstreckung abzuwenden, müsste der Schuldner eine hohe Sicherheitsleistung hinterlegen. Diese Klausel ermöglicht es der obsiegenden Partei, ihre Rechte aus dem Urteil schnell durchzusetzen, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 535 Abs. 2 BGB: Dieser Paragraph regelt die Hauptpflicht des Mieters im Mietverhältnis: die pünktliche und vollständige Zahlung der vereinbarten Miete. Die Miete ist das Entgelt für die Überlassung der Mietsache und muss vertragsgemäß, meist monatlich im Voraus, entrichtet werden. Die Erfüllung dieser Pflicht ist essenziell für das Bestehen eines Mietverhältnisses und bildet die Grundlage für das Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Mieter kamen in diesem Fall ihrer grundlegenden Pflicht aus § 535 Abs. 2 BGB nicht nach, indem sie die Mieten für mehrere Monate nicht fristgerecht zahlten.
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB: Dieser Paragraph ermöglicht es einem Vermieter, ein Mietverhältnis fristlos und damit sofort zu kündigen, wenn der Mieter seine Pflichten in erheblichem Maße verletzt. Ein besonders schwerwiegender Grund ist der qualifizierte Mietrückstand: Dies liegt vor, wenn der Mieter an zwei aufeinanderfolgenden Terminen mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist. Eine solche Pflichtverletzung stört das Vertrauensverhältnis so nachhaltig, dass eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Vermieter unzumutbar wird.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Vermieter sprachen eine fristlose Kündigung aus, weil die Mieter mit den Mieten für September und Oktober 2010 in Verzug geraten waren, was die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB erfüllte.
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB: Diese Vorschrift bietet Mietern eine wichtige Schutzmöglichkeit, die sogenannte Schonfristzahlung. Sie besagt, dass eine fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs unwirksam wird, wenn der Mieter alle rückständigen Mieten bis spätestens zwei Monate nach Zustellung der Räumungsklage vollständig begleicht oder sich eine öffentliche Stelle dazu verpflichtet. Diese Regel soll Mietern eine letzte Chance geben, das Mietverhältnis zu retten, auch wenn die Kündigung bereits ausgesprochen wurde.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Im vorliegenden Fall wurde die fristlose Kündigung der Vermieter unwirksam, da die Mieter die gesamten Mietrückstände innerhalb der gesetzlichen Schonfrist nach Zustellung der Räumungsklage beglichen hatten.
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB: Dieser Paragraph ist die Grundlage für eine wirksame ordentliche Kündigung durch den Vermieter. Anders als bei der fristlosen Kündigung bedarf die ordentliche Kündigung eines „berechtigten Interesses“ des Vermieters. Ein solches Interesse liegt unter anderem vor, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft und erheblich verletzt hat, beispielsweise durch wiederholten oder schwerwiegenden Zahlungsverzug. Die ordentliche Kündigung beendet das Mietverhältnis dann nicht sofort, sondern erst nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfristen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Obwohl die fristlose Kündigung geheilt wurde, begründete der ursprüngliche und erhebliche Mietrückstand der Mieter ein berechtigtes Interesse der Vermieter an der Beendigung des Mietverhältnisses durch die gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung.
- Darlegungs- und Beweislast (Allgemeiner Prozessgrundsatz): Die Darlegungs- und Beweislast ist ein grundlegendes Prinzip im Zivilprozessrecht. Es besagt, dass jede Partei, die sich auf bestimmte Tatsachen beruft, die für sie günstig sind, diese Tatsachen auch vor Gericht schlüssig darlegen und gegebenenfalls beweisen muss. Kann eine Partei die von ihr behaupteten Tatsachen nicht überzeugend darlegen oder beweisen, geht dies zu ihren Lasten, und das Gericht muss davon ausgehen, dass diese Tatsachen nicht existieren oder nicht zutreffen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Mieter konnten ihre Behauptung, der Zahlungsverzug sei unverschuldet gewesen, nicht ausreichend darlegen und beweisen, weshalb das Gericht diese Einlassung nicht berücksichtigte und von einem Verschulden der Mieter ausging.
Das vorliegende Urteil
AG Remscheid – Az.: 7 C 187/10 – Urteil vom 17.03.2011
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.