Stellen Sie sich vor, Ihre Hausverwaltung bucht Geld ab, liefert aber nicht die versprochenen Leistungen. Genau das erlebte eine Eigentümergemeinschaft im Jahr 2019: Über 8.000 Euro für nie erbrachte Sonderleistungen flossen, und sie vernachlässigte Kernpflichten aus dem Verwaltervertrag. Ein Gericht gab der Gemeinschaft Recht, doch die ehemalige Verwalterin weigerte sich, alles zurückzuzahlen.
Übersicht
- Das Wichtigste in Kürze
- Der Fall vor Gericht
- Warum fühlte sich die Eigentümergemeinschaft betrogen?
- Was war der Kern des Streits vor Gericht?
- Wie sah das erste Gericht den Fall?
- Warum musste ein höheres Gericht den Fall neu bewerten?
- Was sind die entscheidenden Unterschiede zwischen Dienst- und Werkvertrag?
- Welche Ansprüche gab das Landgericht der Eigentümergemeinschaft Recht?
- Warum gab es kein Geld für die mangelhafte Grundleistung zurück?
- Welche Fehler des Amtsgerichts korrigierte das Landgericht?
- Wichtigste Erkenntnisse
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag im deutschen Recht?
- Kann die Vergütung bei mangelhafter Erfüllung eines Dienstvertrages einfach gemindert werden?
- Wann kann eine bereits gezahlte Vergütung aufgrund von ungerechtfertigter Bereicherung zurückgefordert werden?
- Welche Handlungsoptionen bestehen, wenn ein Dienstleister seine vertraglichen Pflichten nicht oder nur unzureichend erfüllt?
- Wann beginnt die Verjährungsfrist für Rückforderungsansprüche aus einem Vertrag?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 17 S 147/23 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Dortmund
- Datum: 13.12.2024
- Aktenzeichen: 17 S 147/23
- Verfahren: Berufungsverfahren
- Rechtsbereiche: Vertragsrecht (insbesondere Dienstvertrag und Werkvertrag), Bereicherungsrecht (Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gelder), Verjährungsrecht (Fristen, nach denen Ansprüche verfallen)
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Sie forderte von ihrer ehemaligen Verwalterin Geld zurück, das diese vom Gemeinschaftskonto abgebucht hatte.
- Beklagte: Die ehemalige Wohnungseigentumsverwalterin der Klägerin. Sie wehrte sich gegen die Rückzahlungsforderungen und berief sich auf Verjährung und die Natur des Verwaltervertrags.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Die WEG forderte von ihrer früheren Verwalterin Geld für nicht erbrachte Sonderleistungen und eine Minderung der Grundvergütung wegen mangelhafter Verwaltungstätigkeit zurück. Die Verwalterin widersprach den Forderungen und berief sich auf Verjährung sowie die Rechtsnatur des Verwaltervertrags.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Kann eine Wohnungseigentümergemeinschaft Geld von ihrer ehemaligen Verwalterin zurückfordern, wenn diese versprochene Sonderleistungen nicht erbracht oder andere vertragliche Pflichten nur mangelhaft erfüllt hat?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Das Landgericht änderte das Urteil der Vorinstanz ab und verurteilte die Beklagte zur Rückzahlung von 8.461,64 Euro; die weitergehenden Forderungen der Klägerin wurden abgewiesen und die Berufung der Beklagten im Übrigen zurückgewiesen.
- Zentrale Begründung: Der Verwaltervertrag wurde überwiegend als Dienstvertrag eingeordnet, bei dem eine automatische Minderung der Grundvergütung bei teilweiser Nichterfüllung nicht vorgesehen ist, während nicht erbrachte Sonderleistungen als Ungerechtfertigte Bereicherung zurückzuzahlen sind, sofern keine Verjährung eingetreten ist.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Beklagte muss 8.461,64 Euro plus Zinsen an die Klägerin zahlen; die Klägerin trägt den Großteil der Prozesskosten beider Instanzen, da sie mit ihrem umfassenderen Rückzahlungsanspruch keinen Erfolg hatte.
Der Fall vor Gericht
Warum fühlte sich die Eigentümergemeinschaft betrogen?
Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Jedes Jahr wird für die Verwaltung Ihres gemeinschaftlichen Eigentums, etwa das Treppenhaus, den Garten oder das Dach, eine Verwalterin bestellt. Sie ist die Organisatorin, die dafür sorgt, dass alles läuft, Rechnungen bezahlt und Versammlungen abgehalten werden. Doch im Jahr 2019 hatte die Eigentümergemeinschaft in diesem Fall das Gefühl, dass ihre damalige Verwalterin, eine Firma aus einer westdeutschen Großstadt, ihren Pflichten nicht oder nur unzureichend nachkam. Geld war vom Gemeinschaftskonto abgebucht worden, aber die versprochenen Leistungen, die dafür erbracht werden sollten, fehlten.
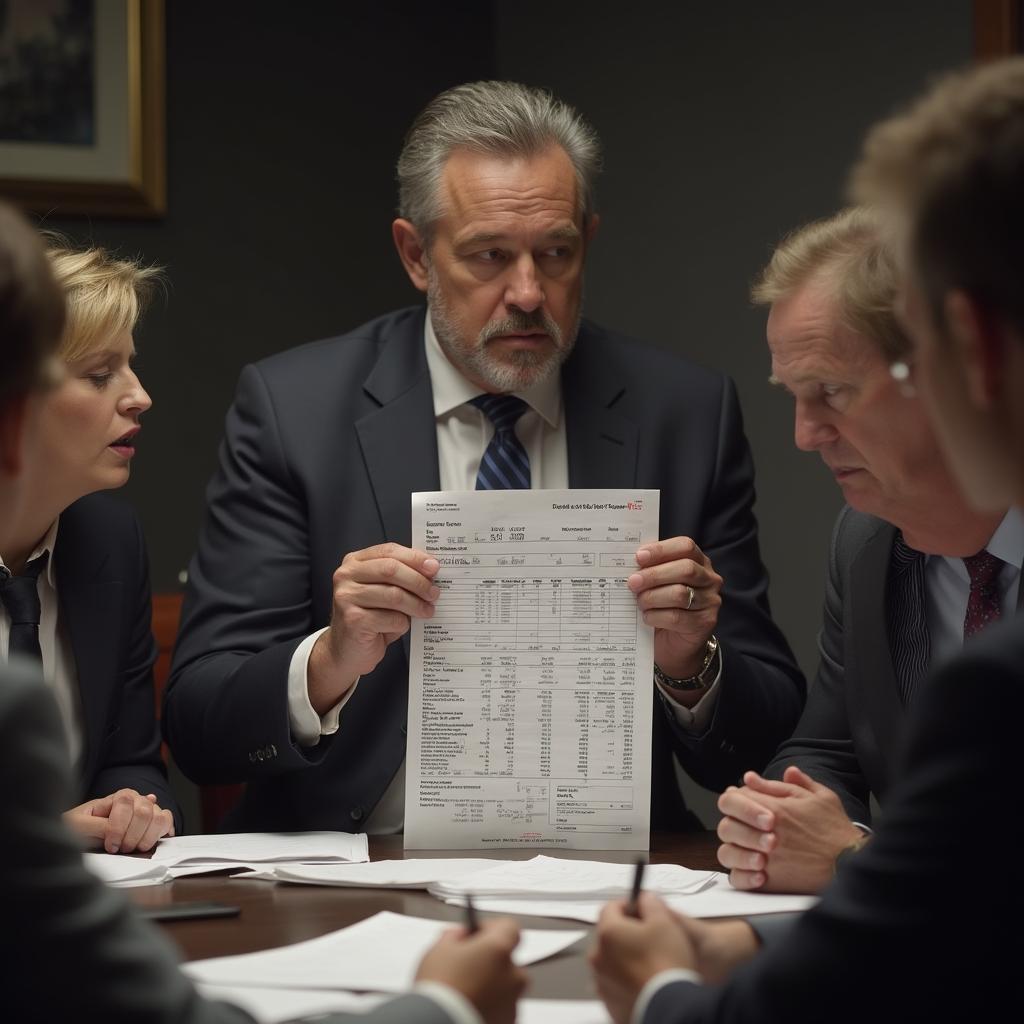
Die Eigentümergemeinschaft war überzeugt, dass ihr zu Unrecht Geld abgenommen wurde und wichtige Aufgaben unerledigt blieben. Sie forderte daher über 8.000 Euro für angeblich erbrachte, aber nie gelieferte Sonderleistungen zurück. Doch damit nicht genug: Die Eigentümer waren der Meinung, dass auch ein Teil der regulären Grundvergütung zurückgezahlt werden müsse, weil wesentliche Pflichten wie die jährliche Eigentümerversammlung oder die Erstellung wichtiger Abrechnungen nicht erfüllt worden waren. Ein örtliches Amtsgericht gab der Eigentümergemeinschaft in erster Instanz weitgehend Recht, doch die ehemalige Verwalterin legte Berufung ein. Nun musste ein höheres Gericht die Sache neu bewerten und entscheiden, wem das Geld eigentlich zusteht und nach welchen Regeln der Fall zu beurteilen ist.
Was war der Kern des Streits vor Gericht?
Der Kern des juristischen Tauziehens drehte sich um zwei Hauptforderungen der Wohnungseigentümergemeinschaft, die sich als Klägerin vor Gericht präsentierte, an ihre ehemalige Verwalterin, die als Beklagte auftrat.
Zum einen verlangte die Eigentümergemeinschaft die Rückzahlung eines genauen Betrages von 8.461,64 Euro. Dieses Geld hatte die Verwalterin vom Gemeinschaftskonto der Eigentümergemeinschaft abgebucht. Der Ärger der Eigentümer rührte daher, dass diese Abbuchungen für sogenannte Sonderleistungen vorgesehen waren, die die Verwalterin laut Vertrag zusätzlich zur Grundvergütung erbringen sollte. Das Problem: Diese Sonderleistungen, so stellte sich im Verfahren heraus und wurde von der Verwalterin auch nicht bestritten, waren im fraglichen Jahr 2019 gar nicht erbracht worden. Die Eigentümer sahen darin eine „ungerechtfertigte Bereicherung“ der Verwalterin – ein Zustand, bei dem jemand etwas erhält, obwohl ihm kein rechtlicher Grund dafür zusteht.
Zum anderen forderte die Eigentümergemeinschaft weitere Rückzahlungen, die sich auf die eigentliche Grundvergütung für das Jahr 2019 bezogen. Hier argumentierten die Eigentümer, die Verwalterin habe ihre vertraglichen Kernpflichten massiv vernachlässigt. Wichtige Aufgaben wie die obligatorische jährliche Eigentümerversammlung, die Erstellung des Wirtschaftsplans und der Jahresabrechnung seien nicht oder nur mangelhaft erledigt worden. Für die Eigentümer stand fest: Wer seine Pflichten nicht erfüllt, darf nicht die volle Vergütung verlangen. Sie suchten nach einer Möglichkeit, die bereits gezahlte Grundvergütung zu „mindern“ oder zurückzufordern.
Die ehemalige Verwalterin hingegen wehrte sich. Hinsichtlich der Rückforderung für die Sonderleistungen berief sie sich auf die „Verjährung“ der Ansprüche. Damit meinte sie, die Forderung sei schlichtweg zu alt und könne nicht mehr eingeklagt werden. Bezüglich der Grundvergütung argumentierte die Verwalterin, der Vertrag mit der Eigentümergemeinschaft sei hauptsächlich ein „Dienstvertrag“. Im Gegensatz zu einem „Werkvertrag“, so ihre Darstellung, gebe es bei einem Dienstvertrag grundsätzlich keine Möglichkeit, die Vergütung bei Nicht- oder Schlechtleistung einfach zu mindern oder zurückzufordern. Sie verneinte daher einen Anspruch der Eigentümergemeinschaft auf Rückzahlung oder Minderung der Grundvergütung.
Wie sah das erste Gericht den Fall?
Das Amtsgericht A1, das als erste Instanz über den Fall zu befinden hatte, gab der Klage der Eigentümergemeinschaft in einem beträchtlichen Umfang statt. Es schien die Sichtweise der Eigentümer zu teilen, dass die Verwalterin aufgrund der mangelhaften oder fehlenden Leistungen nicht die volle Vergütung beanspruchen durfte. Das Amtsgericht ging dabei von einer umfassenderen Rückabwicklung der gezahlten Gelder aus, vor allem basierend auf den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung. Das Ergebnis war, dass die Verwalterin einen deutlich höheren Betrag zurückzahlen sollte, als es der Betrag für die nicht erbrachten Sonderleistungen allein gewesen wäre. Diese Entscheidung warf jedoch die Frage auf, ob die juristischen Grundlagen für eine solche weitreichende Rückzahlung tatsächlich gegeben waren.
Warum musste ein höheres Gericht den Fall neu bewerten?
Mit dem Urteil des Amtsgerichts war die ehemalige Verwalterin nicht einverstanden. Sie legte „Berufung“ ein – ein Rechtsmittel, das dazu dient, ein Urteil von einer höheren Instanz überprüfen zu lassen. Ihr Ziel war es, die vom Amtsgericht angeordnete Zahlungssumme zu reduzieren oder die Klage der Eigentümergemeinschaft gänzlich abweisen zu lassen.
Das Landgericht Dortmund, das nun in zweiter Instanz den Fall auf dem Tisch hatte, musste sich daher grundlegend mit der rechtlichen Einordnung des Verwaltervertrages und den daraus resultierenden Konsequenzen auseinandersetzen. Die zentrale Frage war: Welchem Vertragstyp entspricht ein Wohnungseigentumsverwaltervertrag überhaupt, und welche Regeln gelten, wenn die Verwalterin ihre Pflichten nicht oder nur unzureichend erfüllt? Geht es um eine „Minderung“ wie bei einem mangelhaften Produkt, oder um andere rechtliche Wege?
Was sind die entscheidenden Unterschiede zwischen Dienst- und Werkvertrag?
Um die Entscheidung des Gerichts zu verstehen, ist es unerlässlich, den Unterschied zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag zu kennen – denn diese Unterscheidung war der Dreh- und Angelpunkt des Urteils.
Man kann es sich so vorstellen:
- Der Dienstvertrag: Hierbei schuldet der Auftragnehmer ein Tätigwerden. Er stellt seine Arbeitskraft oder sein Wissen zur Verfügung, ohne dabei einen konkreten Erfolg zu garantieren. Ein gutes Beispiel ist ein Arzt, den Sie aufsuchen: Sie bezahlen ihn für seine fachmännische Untersuchung, Beratung und Behandlung. Er schuldet Ihnen aber nicht zwingend die Heilung einer Krankheit. Er muss sich nur bemühen, Sie bestmöglich zu behandeln. Wenn Sie danach immer noch krank sind, können Sie nicht einfach einen Teil seines Honorars zurückfordern, nur weil der Erfolg ausgeblieben ist. Sie können aber Schadensersatz verlangen, wenn er fehlerhaft gehandelt hat und Ihnen dadurch ein Schaden entstanden ist.
- Der Werkvertrag: Hier schuldet der Auftragnehmer einen konkreten Erfolg. Er verpflichtet sich, ein bestimmtes „Werk“ zu schaffen oder ein Ergebnis herbeizuführen. Denken Sie an einen Schreiner, der Ihnen einen maßgefertigten Schrank baut. Er muss dafür sorgen, dass der Schrank stabil ist, die richtigen Maße hat und richtig zusammengebaut ist. Liefert er ein mangelhaftes Werk ab, das nicht der Vereinbarung entspricht (z.B. der Schrank ist schief), dann können Sie von ihm Nachbesserung verlangen oder unter bestimmten Umständen den Preis mindern. Sie bezahlen ihn erst für das gelungene Ergebnis.
Das Landgericht Dortmund stellte fest, dass der Verwaltervertrag der Eigentümergemeinschaft überwiegend dienstvertraglichen Charakter hat. Die Hauptaufgaben eines Verwalters, wie die Durchführung von Beschlüssen, die Instandhaltung oder die Vermögensverwaltung, sind typische Tätigkeiten, bei denen der Verwalter sich bemüht, die Interessen der Gemeinschaft zu wahren. Er schuldet dabei aber nicht immer einen konkreten, messbaren Erfolg, der sofort als „Werk“ greifbar wäre. Zwar gibt es auch Elemente, die an einen Werkvertrag erinnern könnten, wie die Erstellung eines Wirtschaftsplans oder der Jahresabrechnung – das sind konkrete Arbeitsergebnisse. Doch diese prägen das Gesamtverhältnis nicht derart, dass der gesamte Vertrag als Werkvertrag einzustufen wäre. Diese Unterscheidung war entscheidend, denn sie bestimmte, welche Regeln für die Rückforderung der Vergütung angewendet werden konnten.
Welche Ansprüche gab das Landgericht der Eigentümergemeinschaft Recht?
Das Landgericht Dortmund gab der Eigentümergemeinschaft lediglich in einem Punkt Recht, nämlich bei der Rückforderung der 8.461,64 Euro für die sogenannten Sonderleistungen. Dieser Anspruch wurde als „ungerechtfertigte Bereicherung“ der ehemaligen Verwalterin eingeordnet.
Was bedeutet das? Die Verwalterin hatte dieses Geld durch Abbuchungen vom Konto der Eigentümergemeinschaft erhalten. Dies geschah, weil ihr eine Kontovollmacht erteilt worden war und die Abbuchungen dazu dienen sollten, die zusätzlichen Sonderleistungen zu vergüten. Der entscheidende Punkt war jedoch, dass für diese Leistungen kein gültiger Rechtsgrund existierte, weil die Verwalterin unstreitig keinerlei dieser Sonderleistungen im Jahr 2019 erbracht hatte. Das Geld war also geflossen, ohne dass dafür eine Gegenleistung erfolgte. Dies erfüllte den Tatbestand der ungerechtfertigten Bereicherung, und die Verwalterin musste den Betrag zurückzahlen.
Die Verwalterin hatte zwar versucht, diesen Anspruch mit dem Einwand der „Verjährung“ abzuwehren. Sie behauptete, die Forderung sei zu alt. Das Gericht wies diesen Einwand jedoch zurück. Die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren beginnt erst, wenn der Gläubiger (hier die Eigentümergemeinschaft) Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat oder grob fahrlässig keine Kenntnis hat. Da die Verwalterin den gesamten Zahlungsverkehr abgewickelt hatte, konnte sie nicht nachweisen, dass die Eigentümergemeinschaft bereits Ende 2019 wusste, dass für nicht erbrachte Sonderleistungen Gelder abgebucht wurden. Auch fehlende Versammlungen oder Abrechnungen ließen nicht zwangsläufig darauf schließen, dass auch keine Sonderleistungen erbracht wurden. Da der Mahnbescheid am 2. Januar 2023 zugestellt wurde, war die Verjährung noch nicht eingetreten und wurde durch den Mahnbescheid wirksam gestoppt.
Warum gab es kein Geld für die mangelhafte Grundleistung zurück?
Den weitaus größeren Teil der Forderung – nämlich die Rückzahlung oder Minderung der Grundvergütung aufgrund mangelhafter oder fehlender Kernpflichten (wie die jährliche Versammlung oder die Erstellung der Abrechnungen) – wies das Landgericht Dortmund ab. Die Begründung dafür war vielschichtig und ergab sich aus der bereits erläuterten Einordnung des Verwaltervertrags als überwiegend dienstvertraglicher Natur:
- Keine Minderung bei Dienstverträgen: Im Gegensatz zu einem Werkvertrag, bei dem man den Preis für ein mangelhaftes Produkt mindern kann, ist eine solche Minderung im Dienstvertragsrecht grundsätzlich nicht vorgesehen. Die vereinbarte Vergütung ist der Lohn für die erbrachte Tätigkeit, nicht für einen garantierten Erfolg.
- Handlungsoptionen der Eigentümergemeinschaft: Das Gericht betonte, dass die Eigentümergemeinschaft als „Dienstherrin“ des Verwalters eigene Möglichkeiten gehabt hätte, auf die mangelhaften Leistungen zu reagieren. Sie hätte die Verwalterin zur Pflichterfüllung auffordern, Abmahnungen aussprechen und bei fortgesetzten Mängeln den Vertrag fristlos kündigen können. Eine solche Kündigung hätte dem Vergütungsanspruch der Verwalterin für die Zukunft die Grundlage entzogen. Zudem hätte die Gemeinschaft bei konkreten Schäden, die durch die Versäumnisse entstanden sind, Schadensersatzansprüche geltend machen können. Da die Eigentümergemeinschaft diese Möglichkeiten entweder nicht oder erst sehr spät genutzt und konkrete Schäden nicht ausreichend dargelegt hatte, sah das Gericht keine Veranlassung, ihr nachträglich eine alternative Möglichkeit zur Rückforderung über die Minderung oder ungerechtfertigte Bereicherung zu verschaffen.
- Unpraktikabilität einer Teilrückabwicklung: Der Verwaltervertrag sieht eine pauschale Vergütung für eine Vielzahl von Aufgaben vor, die sowohl dienst- als auch werkvertragliche Elemente umfassen. Eine nachträgliche, teilweise Rückabwicklung der Grundvergütung für einzelne, nicht oder mangelhaft erbrachte Pflichten wäre in der Praxis extrem schwierig. Es wäre kaum möglich, den Wert der erbrachten und nicht erbrachten Leistungen objektiv zu bewerten und zu gewichten, was zu willkürlichen Ergebnissen führen könnte.
Das Gericht stellte also klar: Eine pauschale Rückforderung der Grundvergütung bei einer nur teilweisen Nichterfüllung von Dienstleistungen ist nicht vorgesehen, wenn die Eigentümergemeinschaft andere Wege gehabt hätte, sich zu wehren oder konkrete Schäden geltend zu machen.
Welche Fehler des Amtsgerichts korrigierte das Landgericht?
Das Landgericht Dortmund korrigierte mehrere Annahmen des Amtsgerichts, die zu dessen weitreichenderem Urteil geführt hatten:
- Keine Anwendung der Werkvertrags-Minderung auf die Grundvergütung: Das Amtsgericht hatte möglicherweise angenommen, dass die Vorschriften zur Minderung im Werkvertragsrecht (ähnlich wie bei einem schiefen Schrank) auf die Grundvergütung des Verwalters anwendbar seien. Das Landgericht stellte klar, dass diese Regelungen auf den Vergütungsanspruch eines Verwalters nur in absoluten Ausnahmefällen angewendet werden können und auch dann nur zur Durchsetzung des Leistungsanspruchs, etwa wenn die Gemeinschaft selbst die fehlende Jahresabrechnung erstellen lassen muss und dafür einen Vorschuss vom Verwalter verlangt. Eine automatische Minderung des Vergütungsanspruchs bei Dienstverträgen ist gesetzlich nicht vorgesehen und würde das Konzept des Dienstvertrages unterlaufen.
- Kein Entfallen des Vergütungsanspruchs wegen Unmöglichkeit: Das Amtsgericht hatte eventuell auch die Regelung zur Unmöglichkeit der Leistung herangezogen, die besagt, dass der Anspruch auf Gegenleistung entfällt, wenn eine Leistung unmöglich wird. Das Landgericht betonte, dass diese Regelung nicht greift, wenn die Unmöglichkeit auf einer mangelhaften Leistung des Schuldners beruht. Auch dies würde die spezifischen Gewährleistungsrechte des jeweiligen Vertragstyps (hier Dienstvertrag) untergraben.
- Veraltete Rechtsprechung zur bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung: Das Amtsgericht hatte sich möglicherweise auf ältere Gerichtsurteile gestützt, die eine weitreichendere bereicherungsrechtliche Rückabwicklung vorsahen. Das Landgericht befand jedoch, dass diese frühere Rechtsprechung der aktuellen Rechtslage und der heutigen Sicht auf den Verwaltervertrag nicht mehr entspricht. Da das Gericht keinen rechtlichen Grund für ein Entfallen der Grundvergütung sah, kam auch ein Anspruch auf Rückzahlung dieser Vergütung wegen ungerechtfertigter Bereicherung nicht in Betracht.
Das Landgericht Dortmund sprach der Eigentümergemeinschaft daher nur den Betrag zu, der für die unstreitig nicht erbrachten Sonderleistungen gezahlt worden war. Die weitergehenden Forderungen nach Rückzahlung der Grundvergütung wurden abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits wurden entsprechend des Erfolgs der Parteien aufgeteilt.
Wichtigste Erkenntnisse
Wer als WEG-Verwalter seine Pflichten vernachlässigt, muss nur für völlig unerbrachte Leistungen zurückzahlen – nicht aber für mangelhafte Tätigkeiten im Rahmen der Grundverwaltung.
- Verwalterverträge sind primär Dienstverträge: Ein WEG-Verwalter schuldet seine Tätigkeit und sein Bemühen, nicht aber einen garantierten Erfolg. Mangelhaft erbrachte Kernpflichten berechtigen daher nicht zur Vergütungsminderung wie bei einem defekten Produkt.
- Geld ohne Gegenleistung muss zurück: Kassiert ein Verwalter Honorar für vereinbarte Sonderleistungen, die er nachweislich nie erbracht hat, liegt ungerechtfertigte Bereicherung vor. Diese Beträge sind vollständig zu erstatten.
- Auftraggeber müssen aktiv werden: WEG-Gemeinschaften können bei Pflichtverletzungen ihres Verwalters Abmahnungen aussprechen, den Vertrag kündigen oder Schadensersatz fordern. Wer diese Instrumente nicht nutzt, kann später keine pauschale Rückzahlung der Grundvergütung verlangen.
Die strikte Trennung zwischen Dienst- und Werkvertrag bestimmt, welche Rechte Eigentümergemeinschaften bei mangelhafter Verwaltung tatsächlich haben.
Benötigen Sie Hilfe?
Zweifeln Sie an der Abrechnung Ihres WEG-Verwalters oder nicht erbrachten Sonderleistungen? Gerne prüfen wir Ihren Sachverhalt: Fordern Sie Ihre unverbindliche Ersteinschätzung an.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden, der Verträge aufsetzt, sollte dieses Urteil ab sofort zur Pflichtlektüre gehören. Das Landgericht Dortmund zeichnet hier messerscharf die Grenze: Ein WEG-Verwaltervertrag ist primär ein Dienstvertrag, keine Erfolgsgarantie wie ein Werk. Wer als Eigentümergemeinschaft mit dem Verwalter hadert, muss proaktiv handeln – abmahnen, kündigen, konkret Schadensersatz einfordern – statt auf eine nachträgliche Minderung der Grundvergütung zu spekulieren. Dieses Urteil ist ein Weckruf, der die Eigenverantwortung der WEG schärft und klarstellt, dass Passivität im Schadenfall teuer werden kann.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag im deutschen Recht?
Der wesentliche Unterschied zwischen einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag liegt darin, dass der Dienstvertrag eine Tätigkeit oder ein Bemühen schuldet, während der Werkvertrag einen konkreten Erfolg oder ein bestimmtes Werk zum Ziel hat. Um das Prinzip greifbar zu machen: Wenn Sie einen Arzt aufsuchen, schließen Sie in der Regel einen Dienstvertrag ab. Er schuldet Ihnen seine fachmännische Untersuchung und Behandlung, muss sich also bestmöglich bemühen, schuldet Ihnen aber nicht zwingend die Heilung einer Krankheit. Ein Schreiner hingegen, der Ihnen einen maßgefertigten Schrank baut, schließt einen Werkvertrag ab. Er schuldet Ihnen einen fertigen, mangelfreien Schrank als konkretes Ergebnis.
Diese Unterscheidung ist juristisch sehr wichtig, denn sie bestimmt, welche Rechte die Vertragsparteien haben, wenn die Leistung nicht wie erwartet erbracht wird. Liefert der Schreiner ein mangelhaftes Werk ab, können Sie von ihm Nachbesserung verlangen oder unter bestimmten Umständen den Preis mindern.
Im Gegensatz dazu ist eine solche Minderung der Vergütung im Dienstvertragsrecht grundsätzlich nicht vorgesehen. Hier ist die vereinbarte Vergütung der Lohn für die erbrachte Tätigkeit, nicht für einen garantierten Erfolg. Diese klare Trennung der Vertragstypen sorgt dafür, dass die Rechtsfolgen fair auf die Art der geschuldeten Leistung abgestimmt sind.
Kann die Vergütung bei mangelhafter Erfüllung eines Dienstvertrages einfach gemindert werden?
Nein, die Vergütung bei einem Dienstvertrag kann nicht einfach gemindert werden, wenn die Leistung mangelhaft ist. Dies unterscheidet ihn wesentlich von einem Werkvertrag.
Stellen Sie sich vor, man beauftragt einen Arzt. Man bezahlt ihn für seine Bemühungen und seine fachmännische Behandlung, nicht für eine garantierte Heilung. Bleibt die Krankheit trotz seiner Bemühungen bestehen, kann man nicht einfach einen Teil seines Honorars zurückfordern. Ähnlich ist es bei einem Dienstvertrag: Die Vergütung wird für die erbrachte Tätigkeit bezahlt, nicht zwingend für einen konkreten, messbaren Erfolg.
Ein Dienstvertrag verpflichtet den Auftragnehmer zur Erbringung einer Tätigkeit oder zur Bereitstellung seiner Arbeitskraft, nicht jedoch zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses. Die vereinbarte Vergütung ist der Lohn für die erbrachte Leistung selbst. Dies ist der grundlegende Unterschied zu einem Werkvertrag, bei dem ein spezifisches „Werk“ oder Ergebnis vertraglich vereinbart und bezahlt wird und bei Mängeln eine Preisminderung möglich ist. Da ein Verwaltervertrag überwiegend dienstvertraglichen Charakter hat, ist eine direkte Minderung der Grundvergütung für unzureichende Leistungen nicht vorgesehen.
Stattdessen stehen Auftraggebern andere Wege offen, um auf mangelhafte Dienstleistungen zu reagieren, wie die Aufforderung zur Leistungserfüllung, eine Abmahnung, die fristlose Kündigung des Vertrages oder das Geltendmachen von Schadensersatz, wenn durch die Mängel ein konkreter Schaden entstanden ist. Eine solche Regelung schützt die Rechtssicherheit und verhindert willkürliche nachträgliche Herabsetzungen der vereinbarten Vergütung für erbrachte Dienste.
Wann kann eine bereits gezahlte Vergütung aufgrund von ungerechtfertigter Bereicherung zurückgefordert werden?
Eine bereits gezahlte Vergütung kann aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung zurückgefordert werden, wenn die Zahlung ohne einen gültigen rechtlichen Grund erfolgte oder der Rechtsgrund nachträglich entfiel. Dies trifft zu, wenn jemand etwas erhalten hat, obwohl ihm dafür kein Anspruch zustand.
Man kann sich das so vorstellen wie beim Kauf eines Tickets für ein Konzert, das dann ersatzlos ausfällt. Obwohl man bezahlt hat, wurde die versprochene Leistung – das Konzerterlebnis – nicht erbracht. Ähnlich war es im vorliegenden Fall, als eine Hausverwaltung Geld für sogenannte Sonderleistungen von einer Eigentümergemeinschaft abbuchte, die vereinbarten Zusatzleistungen aber unstreitig nicht erbracht wurden.
In solchen Fällen ist die Zahlung ohne die vorgesehene Gegenleistung erfolgt, wodurch der Rechtsgrund für das Behalten des Geldes von Anfang an fehlte. Es geht dabei nicht um eine Minderung, wie sie etwa bei einem Werkvertrag für mangelhaft erbrachte Leistungen möglich wäre. Bei der ungerechtfertigten Bereicherung fehlt die Leistung oder der Anspruch von vornherein komplett.
Das Landgericht gab der Eigentümergemeinschaft im genannten Fall daher nur bei den Sonderleistungen Recht, weil diese Leistungen eindeutig nicht erbracht und damit keine Gegenleistung für das gezahlte Geld vorhanden war. Das Geld war ohne rechtliche Grundlage geflossen.
Diese Regelung stellt sicher, dass niemand auf Kosten eines anderen ohne rechtliche Rechtfertigung einen Vorteil zieht und gezahltes Geld für nicht erhaltene Leistungen zurückgefordert werden kann.
Welche Handlungsoptionen bestehen, wenn ein Dienstleister seine vertraglichen Pflichten nicht oder nur unzureichend erfüllt?
Wenn ein Dienstleister seine vertraglichen Pflichten nicht oder nur unzureichend erfüllt, ist es entscheidend, proaktiv zu handeln und die bestehenden rechtlichen Handlungsoptionen konsequent zu nutzen. Man sollte nicht passiv bleiben, sondern aktiv die vertragliche Pflichterfüllung einfordern.
Man kann sich dies vergleichen mit einem Gärtner, den man beauftragt hat. Wenn dieser seine Arbeit nur unzureichend erledigt, kann man nicht einfach erwarten, dass die Pflanzen von alleine gedeihen. Stattdessen muss man ihn aktiv zur Leistung auffordern und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen oder finanzielle Nachteile zu vermeiden.
Zunächst sollte man den Dienstleister zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Pflichten auffordern, gegebenenfalls mit einer klaren Fristsetzung. Bleibt die Leistung weiterhin aus, kann man eine formelle Abmahnung aussprechen. Bei fortgesetzter Nichterfüllung kann man den Vertrag, gegebenenfalls auch fristlos, kündigen. Eine solche Kündigung ist wichtig, um die Grundlage für zukünftige Zahlungen zu entziehen. Zusätzlich kann man bei konkreten Schäden, die durch die Pflichtverletzung entstanden sind, einen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen. Das Gericht betont, dass das Ausbleiben einer frühzeitigen und konsequenten Reaktion dazu führte, dass spätere, pauschale Forderungen auf Rückzahlung der Grundvergütung abgewiesen wurden.
Durch schnelles und konsequentes Handeln wahrt man die eigenen Ansprüche und verhindert, dass finanzielle Nachteile entstehen oder sich vergrößern.
Wann beginnt die Verjährungsfrist für Rückforderungsansprüche aus einem Vertrag?
Die allgemeine Verjährungsfrist für Rückforderungsansprüche aus Verträgen beträgt drei Jahre und beginnt regelmäßig mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Anspruchsteller von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
Man kann sich das wie eine Stoppuhr vorstellen: Diese Stoppuhr beginnt nicht einfach zu laufen, sobald ein Ereignis eintritt, sondern erst, wenn die Person, die einen Anspruch hat, auch tatsächlich weiß, dass dieser Anspruch besteht, oder wenn sie dies bei angemessener Sorgfalt hätte wissen müssen. Nur dann ist sie in der Lage, ihren Anspruch geltend zu machen.
Der Zeitpunkt der Kenntnis ist dabei ein entscheidender Punkt in rechtlichen Auseinandersetzungen. Selbst wenn ein Schaden oder eine unberechtigte Zahlung bereits erfolgt ist, startet die Frist erst, wenn die anspruchstellende Person davon erfahren hat oder fahrlässig keine Kenntnis erlangt hat. Kann derjenige, der die Forderung abwehren möchte, nicht nachweisen, dass die andere Seite frühzeitig Kenntnis hatte, beginnt die Frist entsprechend später.
Ist eine Forderung erst einmal verjährt, bedeutet dies zwar nicht, dass der Anspruch nicht mehr existiert, er kann aber vor Gericht nicht mehr erfolgreich durchgesetzt werden. Diese Regelung sorgt für Rechtssicherheit und schützt davor, dass sehr alte Forderungen plötzlich noch geltend gemacht werden, wenn die Beweislage längst schwierig ist.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Dienstvertrag
Bei einem Dienstvertrag schuldet der Auftragnehmer ein Tätigwerden oder das Bemühen, eine Leistung zu erbringen, ohne dabei einen konkreten Erfolg zu garantieren. Das Prinzip ist, dass die Arbeitskraft oder das Wissen einer Person gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird. Der Zweck ist es, Tätigkeiten zu entlohnen, bei denen der Erfolg nicht allein vom Auftragnehmer abhängt oder nicht das primäre Ziel der Vereinbarung ist.
Beispiel: Im Fall hatte der Verwaltervertrag der Eigentümergemeinschaft überwiegend dienstvertraglichen Charakter, da die Verwalterin ihre Tätigkeiten wie die Durchführung von Beschlüssen oder die Vermögensverwaltung erbringen sollte, aber nicht immer einen konkreten, messbaren Erfolg garantieren konnte.
Minderung
Minderung ist ein Recht des Auftraggebers, bei einem mangelhaften „Werk“ den vereinbarten Preis herabzusetzen. Dieses Recht gilt typischerweise bei Werkverträgen und dient dazu, eine faire Balance zwischen der erbrachten, aber mangelhaften Leistung und der dafür zu zahlenden Vergütung herzustellen. Es soll sicherstellen, dass der Besteller nicht den vollen Preis für etwas bezahlen muss, das nicht den vereinbarten Qualitätsstandards entspricht.
Beispiel: Das Landgericht Dortmund stellte klar, dass eine Minderung der Grundvergütung für die Verwalterin nicht in Frage kam, da der Verwaltervertrag überwiegend ein Dienstvertrag war und das Minderungsrecht hier – anders als bei einem Werkvertrag für einen mangelhaften Schrank – grundsätzlich nicht vorgesehen ist.
Ungerechtfertigte Bereicherung
Eine ungerechtfertigte Bereicherung liegt vor, wenn jemand etwas erhält oder einen Vorteil erzielt, für das es keinen gültigen rechtlichen Grund gab oder der Rechtsgrund nachträglich wegfiel. Das Prinzip dahinter ist, dass niemand ohne rechtliche Grundlage auf Kosten eines anderen bereichert werden soll. Der Zweck ist, solche rechtsgrundlosen Vermögensverschiebungen rückgängig zu machen, um die ursprüngliche Vermögenslage wiederherzustellen.
Beispiel: Die Eigentümergemeinschaft forderte die 8.461,64 Euro für nicht erbrachte Sonderleistungen als ungerechtfertigte Bereicherung zurück, weil die Verwalterin das Geld ohne eine entsprechende Gegenleistung erhalten hatte und somit kein rechtlicher Grund für das Behalten des Betrages bestand.
Verjährung
Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kann, auch wenn er ursprünglich bestand. Das Prinzip ist die Schaffung von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden, indem alte Forderungen, für die eine Beweisführung schwierig wird, nicht unbegrenzt geltend gemacht werden können. Die gesetzlichen Fristen sollen sicherstellen, dass Streitigkeiten innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens geklärt werden.
Beispiel: Die ehemalige Verwalterin versuchte, die Rückforderung der Sonderleistungen mit dem Einwand der Verjährung abzuwehren, scheiterte jedoch, weil das Gericht feststellte, dass die Eigentümergemeinschaft keine rechtzeitige Kenntnis von den Abzügen für nicht erbrachte Leistungen hatte und die Verjährungsfrist somit noch nicht begonnen hatte oder unterbrochen wurde.
Werkvertrag
Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Herstellung eines konkreten Werkes oder zum Herbeiführen eines bestimmten Erfolges. Hier steht die Herbeiführung eines messbaren Ergebnisses im Vordergrund, nicht nur die bloße Tätigkeit. Der Zweck ist, die Erstellung oder Reparatur von Sachen sowie die Erbringung von Leistungen mit einem klaren, greifbaren Erfolg rechtlich abzusichern, wobei der Besteller erst für das mangelfreie Ergebnis zahlt.
Beispiel: Das Landgericht betonte den Unterschied zum Dienstvertrag, indem es erklärte, dass ein Schreiner, der einen maßgefertigten Schrank baut, einen Werkvertrag eingeht, da er einen fertigen, mangelfreien Schrank als konkreten Erfolg schuldet und bei Mängeln Rechte wie die Minderung des Preises bestehen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Dienstvertrag und Werkvertrag (§ 611 BGB, § 631 BGB)Diese Unterscheidung legt fest, ob jemand eine reine Tätigkeit oder einen konkreten Erfolg schuldet und welche Rechte und Pflichten daraus entstehen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Einordnung des Verwaltervertrags als überwiegend dienstvertraglich war entscheidend, da dies die Möglichkeiten zur Rückforderung der Grundvergütung stark einschränkte.
- Grundsatz der fehlenden Minderung bei Dienstverträgen (Prinzip)Bei einem Dienstvertrag kann die Vergütung nicht einfach gekürzt werden, nur weil der gewünschte Erfolg ausbleibt oder die Leistung nicht perfekt war, da die vereinbarte Gegenleistung die Tätigkeit selbst ist.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Weil der Verwaltervertrag überwiegend ein Dienstvertrag ist, konnten die Eigentümer die Grundvergütung nicht einfach mindern oder vollständig zurückfordern, auch wenn die Verwalterin Kernpflichten vernachlässigt hatte.
- Ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB)Wer etwas ohne rechtlichen Grund erhält, muss es an denjenigen zurückgeben, dessen Vermögen ungerechtfertigt vermehrt wurde.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Verwalterin musste die Gelder für nicht erbrachte Sonderleistungen zurückzahlen, da sie diese ohne gültigen Rechtsgrund, also ungerechtfertigt, erhalten hatte.
- Verjährung (§ 195 BGB i.V.m. § 199 Abs. 1 BGB)Eine Forderung kann nach Ablauf einer bestimmten Zeit rechtlich nicht mehr durchgesetzt werden, um Rechtsfrieden und Sicherheit zu schaffen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Verwalterin versuchte, die Rückforderung der Sonderleistungen mit dem Einwand der Verjährung abzuwehren, scheiterte aber, da die dreijährige Frist noch nicht begonnen hatte bzw. durch den Mahnbescheid rechtzeitig gestoppt wurde.
Das vorliegende Urteil
LG Dortmund – Az.: 17 S 147/23 – Urteil vom 13.12.2024
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









