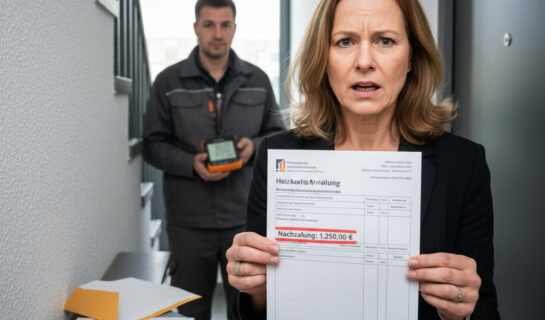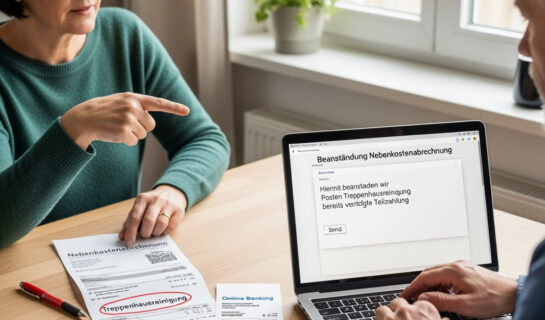Ein Wohnungseigentümer in Hamburg zog vor Gericht, um zwei Beschlüsse seiner WEG anzufechten, die er wegen Abrechnungsfehlern und einer Anwaltsbeauftragung als unzulässig ansah. Doch das Gericht wies die Klage vollständig ab und bestätigte die Rechtmäßigkeit beider Beschlüsse.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Warum klagte ein Wohnungseigentümer gegen die eigene Gemeinschaft wegen einer Abrechnung und einer Anwaltsbeauftragung?
- Weshalb hielt der Kläger die Jahresabrechnung 2023 für fehlerhaft?
- Aus welchen Gründen war der Beschluss zur Anwaltsbeauftragung in den Augen des Klägers unwirksam?
- Warum erklärte das Gericht die Wohngeldabrechnung 2023 für gültig?
- Wieso bestätigte das Gericht die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zur Anwaltsbeauftragung?
- Wie fiel das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg letztlich aus?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil 980b C 3/25 WEG | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft war mit zwei Entscheidungen nicht einverstanden. Er bemängelte die Jahresabrechnung und die Beauftragung eines Anwalts für den Abriss einer ungenehmigten Baumaßnahme.
- Die Rechtsfrage: Durfte die Gemeinschaft diese Jahresabrechnung so beschließen und einen Anwalt unter den genannten Bedingungen beauftragen?
- Die Antwort: Nein, seine Klage wurde abgewiesen. Das Gericht sah beide Entscheidungen als korrekt an, da die Jahresabrechnung stimmte und die Anwaltsbeauftragung den Regeln entsprach.
- Die Bedeutung: Eine Gemeinschaft kann Kosten direkt einem Eigentümer zuordnen, wenn dieser zustimmt. Die Verwaltung kann einen Anwalt beauftragen, auch wenn dessen Name vorher nicht feststeht, solange der Kostenrahmen klar ist.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Amtsgericht Hamburg-St. Georg
- Datum: 25.07.2025
- Aktenzeichen: 980b C 3/25 WEG
- Verfahren: Zivilklage
- Rechtsbereiche: Wohnungseigentumsrecht, Prozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ein Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Er wollte zwei Beschlüsse der Eigentümerversammlung für ungültig erklären lassen.
- Beklagte: Die Wohnungseigentümergemeinschaft. Sie wollte die angefochtenen Beschlüsse beibehalten.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Ein Wohnungseigentümer klagte gegen zwei Beschlüsse seiner Eigentümergemeinschaft. Er beanstandete die Wohngeldabrechnung und die Beauftragung eines Anwalts zur Durchsetzung eines Rückbauanspruchs wegen einer Terrassenüberdachung.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Durften die Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft zur Jahresabrechnung und zur Beauftragung eines Anwalts so gefasst werden, oder waren sie ungültig?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Klage wird abgewiesen.
- Zentrale Begründung: Die angefochtenen Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft sind gültig und entsprechen den Regeln einer ordnungsgemäßen Verwaltung.
- Konsequenzen für die Parteien: Der Kläger verlor den Prozess und muss die Gerichtskosten tragen.
Der Fall vor Gericht
Warum klagte ein Wohnungseigentümer gegen die eigene Gemeinschaft wegen einer Abrechnung und einer Anwaltsbeauftragung?
Ein Mitglied einer Hamburger Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) zog vor das Amtsgericht Hamburg-St. Georg, um zwei Beschlüsse anzufechten, die auf einer Eigentümerversammlung am 9. Dezember 2024 gefasst wurden.

Im Zentrum des Streits standen die Jahresabrechnung für 2023 und die Entscheidung, einen Anwalt mit der Durchsetzung eines Rückbauanspruchs zu beauftragen. Der Kläger war der Ansicht, beide Beschlüsse seien fehlerhaft und verstießen gegen die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Verwaltung, ein Kernprinzip des Wohnungseigentumsrechts, das vorschreibt, dass alle Entscheidungen im Interesse der Gemeinschaft und nachvollziehbar sein müssen. Er forderte das Gericht auf, die Beschlüsse für ungültig zu erklären.
Weshalb hielt der Kläger die Jahresabrechnung 2023 für fehlerhaft?
Der erste Streitpunkt betraf die Genehmigung der Wohngeldabrechnung 2023. Diese Abrechnung listet alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft auf und verteilt sie auf die einzelnen Eigentümer. Der Kläger rügte hier zwei konkrete Punkte.
Zum einen störte er sich an der Verteilung eines Betrags von 154,94 Euro für eine Position namens „Instandhaltung SE“. SE steht hier für Sondereigentum, also den Teil eines Gebäudes, der einem einzelnen Eigentümer allein gehört, wie die Wohnung selbst. Hintergrund war, dass in der Wohnung eines anderen Eigentümers auf dessen Wunsch ein Heizkörper ausgetauscht wurde. Die Verwaltung hatte den Auftrag erteilt und die Rechnung zunächst vom Gemeinschaftskonto bezahlt. In der Jahresabrechnung wurde dieser Betrag dann aber nicht auf alle Eigentümer verteilt, sondern vollständig dem Eigentümer zugewiesen, der den neuen Heizkörper erhalten hatte. Der Kläger argumentierte, dass dies ein Fehler sei. Seiner Meinung nach hätte die Gemeinschaft die Kosten tragen müssen, wodurch auf ihn selbst ein Anteil von 4,30 Euro entfallen wäre.
Zum anderen beanstandete der Eigentümer die Abrechnung der Gesamtkosten für „Heizung/Wasser“. Die Abrechnung wies hierfür Gesamtkosten von 65.352,45 Euro aus. In seiner Einzelabrechnung fand sich der Kläger jedoch nur an der Verteilung eines Teilbetrags von 30.429,34 Euro beteiligt. Für ihn war diese Diskrepanz ein klarer Hinweis auf eine undurchsichtige und damit fehlerhafte Abrechnung. Er konnte nicht nachvollziehen, warum er nicht an der Verteilung der gesamten Summe beteiligt war.
Aus welchen Gründen war der Beschluss zur Anwaltsbeauftragung in den Augen des Klägers unwirksam?
Der zweite angegriffene Beschluss betraf eine bauliche Veränderung auf dem Gemeinschaftseigentum. Ein Miteigentümer hatte im September 2024 auf seiner Terrasse eine Überdachung errichtet. Da er dafür keine Genehmigung der Gemeinschaft hatte, forderte die Verwaltung ihn mehrfach vergeblich auf, die Konstruktion wieder zu entfernen. Daraufhin beschloss die Eigentümerversammlung mit Mehrheit, einen Anwalt einzuschalten, um den Rückbau notfalls auch gerichtlich durchzusetzen.
Für die Finanzierung dieses Vorgehens wurde eine Sonderumlage von 3.200 Euro beschlossen. Eine Sonderumlage ist eine einmalige Zahlung, die alle Eigentümer zusätzlich zum regulären Wohngeld leisten müssen, um unerwartete oder hohe Kosten zu decken. Der Beschluss ermächtigte die Verwaltung außerdem, eine Anwaltskanzlei mit „speziellen Kenntnissen im Wohnungseigentumsrecht“ zu beauftragen und eine Vergütungsvereinbarung über ein Stundenhonorar zwischen 150 und 300 Euro zu schließen. Die prognostizierten Kosten wurden auf 3.000 Euro beziffert.
Der Kläger hielt diesen Beschluss aus mehreren formalen und inhaltlichen Gründen für rechtswidrig:
- Fehlender Grundbeschluss: Er meinte, die Gemeinschaft hätte in einem ersten Schritt erst einmal grundsätzlich beschließen müssen, ob sie überhaupt gegen die Terrassenüberdachung vorgehen will. Erst in einem zweiten, separaten Beschluss hätte über das Wie entschieden werden dürfen, also die Beauftragung eines Anwalts zu bestimmten Konditionen.
- Unzulässige Vergütungsvereinbarung: Eine Vereinbarung über ein Stundenhonorar anstelle der gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) sei nur bei Vorliegen „besonderer Gründe“ zulässig. Solche Gründe seien nicht ersichtlich.
- Mangelnde Bestimmtheit und Kontrolle: Der Beschluss sei zu unbestimmt. Weder wurde der Name des Anwalts genannt, noch wurden Vergleichsangebote eingeholt. Die weite Spanne des Stundenhonorars und das Kostenvolumen von 3.000 Euro seien unverhältnismäßig. Dies gebe der Verwaltung einen zu großen, unkontrollierten Spielraum.
Warum erklärte das Gericht die Wohngeldabrechnung 2023 für gültig?
Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg wies die Klage vollständig ab und erklärte beide Beschlüsse für rechtmäßig. Die Richter zerlegten die Argumente des Klägers Punkt für Punkt.
Bezüglich der Jahresabrechnung 2023 sah das Gericht keinen Fehler. Die direkte Zuweisung der Heizkörper-Kosten von 154,94 Euro an den verursachenden Eigentümer war korrekt. Das Gericht erklärte hierzu eine wichtige Regel des Wohnungseigentumsrechts. Normalerweise werden Kosten nach Miteigentumsanteilen verteilt, wie im § 16 Abs. 2 WEG festgelegt. Es gibt jedoch Ausnahmen. Gemäß § 28 Abs. 2 WEG darf in der Abrechnung von dieser Regel abgewichen werden, wenn die Gemeinschaft einen Anspruch auf Ersatz der Kosten gegen einen einzelnen Eigentümer hat und dieser Anspruch entweder rechtskräftig festgestellt („tituliert“) ist oder „sonst feststeht“.
Im vorliegenden Fall hatte der betroffene Eigentümer der Kostenübernahme bereits vor der Versammlung zugestimmt. Seine Zahlungspflicht war also unstreitig und damit „sonst feststehend“. Die Gemeinschaft musste ihn nicht erst verklagen, sondern durfte die Kosten direkt in seiner Einzelabrechnung verbuchen. Das ist so, als ob jemand eine Rechnung nicht nur erhält, sondern auch mündlich bestätigt, dass er sie bezahlen wird.
Auch die vermeintliche Unstimmigkeit bei den Heizkosten war nach Ansicht des Gerichts keine. Sie beruhte auf einem Missverständnis des Klägers. Die Wohnanlage bestand aus zwei getrennten Gebäudekomplexen. Die Heizkostenverordnung (HeizKVO) schreibt in solchen Fällen vor, dass die Heizkosten für jede Liegenschaft getrennt erfasst und abgerechnet werden müssen. Der Kläger wurde daher korrekterweise nur an den Kosten seines eigenen Gebäudeteils beteiligt und nicht an den Gesamtkosten der gesamten Anlage. Die Abrechnung war somit nicht fehlerhaft, sondern folgte exakt den gesetzlichen Vorgaben.
Wieso bestätigte das Gericht die Rechtmäßigkeit des Beschlusses zur Anwaltsbeauftragung?
Auch der Beschluss zur Beauftragung des Anwalts hielt der gerichtlichen Prüfung stand. Die Argumentation des Klägers wurde in allen Punkten zurückgewiesen.
Das Gericht stellte klar, dass kein separater „Grundbeschluss“ erforderlich war. Aus dem Protokoll der Versammlung ging eindeutig hervor, dass die Eigentümer sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ des Vorgehens entschieden hatten. Der Beschlusstext machte unmissverständlich deutlich, dass die Gemeinschaft den Rückbauanspruch durchsetzen wollte und zu diesem Zweck die Verwaltung mit der Anwaltsbeauftragung betraute. Beides in einem Beschluss zu verbinden, ist rechtlich zulässig, solange der Wille der Gemeinschaft klar erkennbar ist.
Der entscheidende Punkt war die Ermächtigung der Verwaltung. Nach § 27 Abs. 2 WEG können die Eigentümer der Verwaltung bestimmte Entscheidungsbefugnisse übertragen. Das Gericht folgte hier der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) und befand, dass die Delegation im vorliegenden Fall den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung entsprach. Die Vorgaben im Beschluss waren ausreichend konkret:
- Anforderungsprofil: Es sollte eine Kanzlei mit „speziellen Kenntnissen im Wohnungseigentumsrecht“ sein.
- Kostenrahmen: Der Stundensatz wurde auf 150 bis 300 Euro begrenzt, ein in Hamburg für spezialisierte Anwälte marktüblicher Rahmen.
- Kostenobergrenze: Das prognostizierte Volumen von 3.000 Euro fungierte als klares Budget, das die Verwaltung nicht ohne Weiteres überschreiten durfte.
Die Forderung des Klägers, der Anwalt hätte namentlich benannt oder Vergleichsangebote eingeholt werden müssen, verwarf das Gericht. Die Eigentümer hatten ihre Auswahlkompetenz bewusst an die Verwaltung delegiert. Diese muss im Rahmen ihrer Pflichten eine geeignete Kanzlei auswählen. Eine Pflicht, dies im Vorfeld durch das Einholen von Angeboten zu dokumentieren oder den Anwalt bereits im Beschluss festzulegen, besteht nicht. Dies wäre laut Gericht lebensfremd und würde die Flexibilität der Verwaltung unnötig einschränken.
Wie fiel das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg letztlich aus?
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass keiner der beiden angefochtenen Beschlüsse rechtswidrig war. Sowohl die Genehmigung der Jahresabrechnung 2023 als auch der Beschluss zur Beauftragung eines Anwalts entsprachen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung und den gesetzlichen Vorgaben. Die Klage wurde daher vollständig abgewiesen. Als Konsequenz muss der Kläger die gesamten Kosten des Rechtsstreits tragen. Die Beschlüsse der Eigentümerversammlung vom 9. Dezember 2024 bleiben damit in Kraft.
Die Urteilslogik
Das Gericht klärt zentrale Streitfragen im Wohnungseigentumsrecht und stärkt die Handlungssicherheit von Gemeinschaften und Verwaltungen.
- Direkte Kostenverrechnung: Eine Wohnungseigentümergemeinschaft darf Kosten für Maßnahmen am Sondereigentum direkt dem verursachenden Eigentümer zurechnen, wenn dessen Zahlungspflicht unzweifelhaft feststeht.
- Gebäudespezifische Heizkosten: Die Heizkostenverordnung schreibt vor, dass Wohnanlagen mit getrennten Gebäudeteilen ihre Heizkosten für jeden Abschnitt eigenständig verteilen.
- Flexibilität bei Anwaltsbeauftragung: Die Wohnungseigentümergemeinschaft ermächtigt ihre Verwaltung wirksam zur Anwaltsbeauftragung, indem sie klare Vorgaben zu Fachgebiet, Honorarrahmen und Budget festlegt; die Verwaltung muss dafür weder Namen nennen noch vorab Vergleichsangebote einholen.
Solche Präzisierungen schaffen Rechtssicherheit und ermöglichen eine effiziente Verwaltung von Gemeinschaftseigentum.
Benötigen Sie Hilfe?
Sind Ihre WEG-Abrechnungen fehlerhaft oder Beschlüsse ungültig? Erhalten Sie eine unverbindliche erste Einschätzung Ihrer rechtlichen Situation.
Das Urteil in der Praxis
Wer als WEG-Verwalter künftig Rechtssicherheit sucht, findet in diesem Urteil eine klare Handlungsanleitung. Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg stärkt hier massiv die Handlungsfähigkeit von Wohnungseigentümergemeinschaften, indem es die pragmatische Delegation von Kompetenzen bestätigt. Die explizite Anerkennung, dass die Verwaltung die Anwaltsauswahl samt Honorarrahmen übernehmen darf, ohne namentliche Nennung oder Vergleichsangebote, ist ein entscheidender Fortschritt. Dieses Urteil räumt mit überzogenen Formalismus-Forderungen auf und ermutigt WEGs, effizient und zielgerichtet im Rahmen klar definierter Budgets vorzugehen – ein echter Gewinn für die Rechtssicherheit im Tagesgeschäft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was macht meine WEG Jahresabrechnung rechtlich korrekt?
Eine WEG Jahresabrechnung ist dann juristisch wasserdicht, wenn sie den strengen Grundsätzen der ordnungsmäßigen Verwaltung folgt und die gesetzlichen Vorgaben, etwa aus dem Wohnungseigentumsgesetz, erfüllt. Transparenz ist dabei das A und O: Jede Ausgabe, jede Einnahme muss klar ersichtlich und nachvollziehbar sein, damit die Kosten fair und korrekt verteilt werden, selbst bei Abweichungen von der Regelfallverteilung.
Der Grund? Eine korrekte Abrechnung ist wie ein detaillierter Kassenbon, der exakt zeigt, wofür Gemeinschaftsgelder verwendet wurden und warum jeder seinen spezifischen Anteil schuldet. Sie verhindert Streit und schafft Vertrauen unter den Eigentümern. Nur so sind Beschlüsse der Gemeinschaft auch anfechtungssicher.
Gerichte bestätigen dies immer wieder. Ein Hamburger Fall zeigte beispielsweise, wie die Kosten für einen Heizkörper im Sondereigentum eines Eigentümers direkt diesem zugewiesen werden konnten – obwohl die Gemeinschaft die Rechnung zunächst gezahlt hatte. Entscheidend war die Zustimmung des Eigentümers zur Kostenübernahme, wodurch seine Zahlungspflicht „feststand“. § 28 Abs. 2 WEG erlaubt solche direkten Zuweisungen, wenn Ansprüche gegen einzelne Eigentümer unstreitig sind, abweichend von der sonst üblichen Verteilung nach Miteigentumsanteilen. Ebenso kann die Trennung von Heizkosten für verschiedene Gebäudeteile notwendig und korrekt sein, wie die Heizkostenverordnung vorschreibt.
Überprüfen Sie Ihre WEG Jahresabrechnung immer genauestens, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Kann ich eine WEG Jahresabrechnung rechtlich anfechten?
Eine WEG Jahresabrechnung anfechten? Absolut! Eigentümer können eine solche Abrechnung gerichtlich überprüfen lassen, wenn sie Fehler vermuten oder sie nicht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht – entscheidend ist jedoch schnelles Handeln, denn dafür gelten knappe Fristen nach der Eigentümerversammlung.
Jeder Wohnungseigentümer hat das Recht, die finanzielle Führung seiner Gemeinschaft zu hinterfragen. Das Amtsgericht Hamburg sah sich erst kürzlich mit einer solchen Klage konfrontiert. Der Kläger bemängelte die Jahresabrechnung 2023 massiv. Er sah darin nicht nur konkrete Fehler, sondern auch Verstöße gegen die Transparenzpflichten, die eine ordnungsgemäße Verwaltung vorschreibt.
Konkret ging es um die Verteilung von Sondereigentumskosten für einen Heizkörper oder die vermeintlich undurchsichtige Abrechnung der gesamten Heizkosten des Objekts. Gerichte prüfen in solchen Fällen akribisch, ob die Verteilungsschlüssel stimmen und jede Position nachvollziehbar ist. Jeder Cent zählt – und muss sauber dokumentiert sein.
Prüfen Sie Ihre WEG Jahresabrechnung daher immer penibel; nur so können Sie Ihre Rechte fristgerecht wahren und bei Bedenken einen Anwalt konsultieren.
Muss meine WEG nach ordnungsmäßiger Verwaltung handeln?
Ja, Ihre Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) muss zwingend nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Verwaltung handeln. Das ist kein optionaler Leitfaden, sondern ein gesetzliches Kernprinzip des Wohnungseigentumsrechts, das sicherstellt, dass alle Entscheidungen im besten Interesse der gesamten Gemeinschaft getroffen werden – transparent und nachvollziehbar.
Stellen Sie sich das vor wie die Geschäftsordnung eines Unternehmens: Sie schützt vor Willkür und sichert, dass Beschlüsse nicht auf Zuruf, sondern fundiert und zum Wohle aller fallen. Dieses Fundament verhindert, dass einzelne Interessen die Gemeinschaft dominieren und garantiert jedem Eigentümer Rechtssicherheit.
Gerichte überprüfen genau, ob diese Grundsätze eingehalten wurden. Ein aktueller Fall aus Hamburg zeigt, wie streng das gehandhabt wird: Dort klagte ein Eigentümer gegen seine WEG, weil er Abrechnungen und die Beauftragung eines Anwalts nicht als ordnungsgemäß empfand. Das Amtsgericht Hamburg-St. Georg zerlegte die Argumente Punkt für Punkt.
Die Richter bestätigten beide Beschlüsse. Warum? Weil die Gemeinschaft im Kern richtig agiert hatte – trotz des Streits um Details wie Heizkostenverteilung oder Anwaltshonorare. Die Entscheidungen waren nachvollziehbar und entsprachen den gesetzlichen Vorgaben, was die ordnungsgemäße Verwaltung unterstrich. Überprüfen Sie deshalb immer kritisch, ob Ihre WEG-Beschlüsse transparent sind und wirklich dem Gemeinschaftsinteresse dienen, um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Wie darf meine WEG einen Anwalt beauftragen?
Ihre WEG darf einen Anwalt beauftragen, indem sie einen präzisen Beschluss fasst, der nicht nur den Zweck des juristischen Vorgehens klar definiert, sondern auch das Anforderungsprofil der Kanzlei und einen realistischen Kostenrahmen. Die rechtlich zulässige Delegation dieser Beauftragung an die Hausverwaltung erfordert dabei exakt formulierte Vorgaben.
Warum dieser formale Tanz? Juristen nennen das den Grundsatz der ordnungsmäßigen Verwaltung. Jede Ausgabe, jede strategische Entscheidung Ihrer Gemeinschaft muss nachvollziehbar, transparent und im Interesse aller Eigentümer sein. Ein vager Beschluss gibt der Verwaltung einen Blankoscheck – das wird teuer, wenn der Kostenrahmen nicht definiert ist.
Gerichte legen hier präzise Maßstäbe an. So befand das Amtsgericht Hamburg-St. Georg, dass die WEG die Anwaltsauswahl an die Verwaltung delegieren darf, solange der Beschluss genügend Kontrolle bietet. Ausreichend waren Angaben wie „Kanzlei mit speziellen Kenntnissen im Wohnungseigentumsrecht“, ein Stundenhonorar zwischen 150 und 300 Euro und eine Budgetobergrenze von 3.000 Euro für das gesamte Verfahren. Der Name der Kanzlei? Vergleichsangebote? Nicht zwingend erforderlich, urteilten die Richter. Das wäre lebensfremd.
Achten Sie darauf: Der Beschluss muss der Verwaltung Handlungsfreiheit geben, aber keine unkontrollierte Macht.
Was passiert, wenn ich Kostenübernahme in der WEG zustimme?
Eine klare Zustimmung zur Kostenübernahme innerhalb der WEG hat direkte, bindende Konsequenzen: Der Betrag darf ohne Umwege auf Ihrer Einzelabrechnung erscheinen. Juristen nennen das „sonst feststehend“. Das bedeutet, die Gemeinschaft muss Sie nicht erst verklagen, um an ihr Geld zu kommen.
Der Grund: Ist Ihre Zahlungspflicht unstreitig – etwa durch eine mündliche oder schriftliche Zusage – entfällt der Bedarf an einem langwierigen Gerichtsverfahren. Das Wohnungseigentumsgesetz erlaubt nach § 28 Abs. 2 WEG eine direkte Zuordnung in der Jahresabrechnung, falls der Anspruch bereits rechtskräftig festgestellt oder eben „sonst feststehend“ ist. Gerichte bestätigen solche Praktiken immer wieder.
Stellen Sie sich vor, ein Heizkörper in Ihrem Sondereigentum muss ausgetauscht werden. Die WEG-Verwaltung beauftragt die Arbeit und bezahlt die Rechnung vom Gemeinschaftskonto. Haben Sie vorab zugesagt, diese spezifischen Kosten selbst zu tragen, darf die Verwaltung den vollen Betrag direkt Ihnen in Rechnung stellen. Dieser Betrag taucht dann nicht als Gemeinschaftsausgabe auf, die nach Miteigentumsanteilen verteilt wird, sondern landet allein auf Ihrer individuellen Abrechnung. Klingt hart? Es ist reine Konsequenz Ihrer Zusage.
Prüfen Sie jede Zusage zur Kostenübernahme in der WEG genau, bevor sie zur bitteren Pille auf Ihrer Abrechnung wird.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung
Juristen bezeichnen die Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung als das zentrale Leitprinzip im Wohnungseigentumsrecht, das sicherstellt, dass alle Entscheidungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft im Interesse aller und transparent getroffen werden. Dieses Prinzip dient dazu, Willkür zu verhindern und Rechtssicherheit für jeden einzelnen Eigentümer zu schaffen. Das Gesetz will damit garantieren, dass Beschlüsse nicht nur rechtmäßig, sondern auch sachgerecht und nachvollziehbar sind.
Beispiel: Im vorliegenden Fall musste das Amtsgericht Hamburg-St. Georg prüfen, ob die angefochtenen Beschlüsse, insbesondere zur Jahresabrechnung und Anwaltsbeauftragung, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung entsprachen.
Sonderumlage
Eine Sonderumlage ist eine außerplanmäßige, einmalige Zahlung, die Wohnungseigentümer zusätzlich zum regulären Wohngeld leisten müssen, um unvorhergesehene oder besonders hohe Ausgaben der Gemeinschaft zu finanzieren. Diese Regelung ermöglicht es einer Wohnungseigentümergemeinschaft, schnell auf dringende finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne langwierige Kreditaufnahmen oder die Ansammlung überhöhter Rücklagen. Sie sichert die Liquidität für außerordentliche Projekte.
Beispiel: Zur Finanzierung der Anwaltsbeauftragung, die den Rückbau der Terrassenüberdachung durchsetzen sollte, beschloss die Eigentümerversammlung eine Sonderumlage von 3.200 Euro.
Sondereigentum
Sondereigentum bezeichnet den Teil einer Immobilie, der im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft einem einzelnen Eigentümer allein gehört und von diesem exklusiv genutzt wird. Das Konzept des Sondereigentums ermöglicht individuelle Nutzung und Gestaltung innerhalb eines Mehrparteienhauses, während gleichzeitig die gemeinsame Nutzung des Gemeinschaftseigentums geregelt wird. Es schafft klare Verantwortlichkeiten für Instandhaltung und Kosten.
Beispiel: Die Kosten für den Heizkörper, der im Sondereigentum eines anderen Eigentümers ausgetauscht wurde, waren ein zentraler Streitpunkt in der Jahresabrechnung, weil der Kläger die Zuweisung anzweifelte.
Sonst feststehender Anspruch
Ein sonst feststehender Anspruch liegt juristisch vor, wenn eine Forderung der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen einen einzelnen Eigentümer zwar nicht gerichtlich festgestellt ist, ihre Berechtigung und Höhe aber unstreitig sind, zum Beispiel durch eine ausdrückliche Zusage des Schuldners. Diese Bestimmung aus § 28 Abs. 2 WEG vereinfacht die Abrechnung und vermeidet unnötige Gerichtsverfahren, indem sie der Verwaltung erlaubt, unstreitige Forderungen direkt in der Einzelabrechnung des betroffenen Eigentümers zu berücksichtigen. Sie fördert effizientes Verwaltungshandeln.
Beispiel: Weil der betroffene Eigentümer der Kostenübernahme für den Heizkörper zugestimmt hatte, durfte die Gemeinschaft den Betrag als sonst feststehenden Anspruch direkt in seiner Einzelabrechnung verbuchen.
Vergütungsvereinbarung
Eine Vergütungsvereinbarung ist eine vertragliche Regelung zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten über das Honorar, die von den gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) abweichen kann. Solche Vereinbarungen ermöglichen flexible Honorarmodelle, insbesondere bei komplexen oder zeitaufwendigen Fällen, für die die gesetzlichen Gebühren nicht angemessen wären. Das Gesetz fordert dabei besondere Gründe und Transparenz, um den Mandanten zu schützen.
Beispiel: Die Eigentümerversammlung ermächtigte die Verwaltung, eine Vergütungsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei über ein Stundenhonorar zwischen 150 und 300 Euro für die Durchsetzung des Rückbauanspruchs zu schließen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Grundsatz der ordnungsmäßigen Verwaltung (Allgemeines Rechtsprinzip)Alle Entscheidungen einer Wohnungseigentümergemeinschaft müssen im Interesse der Gemeinschaft und nachvollziehbar sein, um ihre Gültigkeit zu behalten.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht prüfte die angefochtenen Beschlüsse – die Jahresabrechnung und die Anwaltsbeauftragung – genau daraufhin, ob sie diesem grundlegenden Prinzip entsprachen und damit rechtmäßig waren.
- Verteilung von Kosten bei Sondereigentum (§ 28 Abs. 2 WEG)Kosten, die einem einzelnen Eigentümer eindeutig zuzurechnen sind und dessen Zahlungspflicht feststeht, dürfen in der Jahresabrechnung direkt diesem Eigentümer zugewiesen werden, auch wenn die allgemeine Verteilung nach Miteigentumsanteilen erfolgt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Kosten für den Heizkörper-Austausch konnten direkt dem verursachenden Eigentümer zugerechnet werden, da dieser die Kostenübernahme bereits zugesagt hatte und seine Zahlungspflicht damit „feststand“.
- Heizkostenverordnung (HeizKVO)Die Heizkostenverordnung regelt, wie Heiz- und Warmwasserkosten abzurechnen sind, insbesondere, dass sie bei mehreren voneinander getrennten Gebäudeteilen separat erfasst und abgerechnet werden müssen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die scheinbare Diskrepanz bei den Heizkosten war korrekt, da die Wohnanlage aus zwei separaten Gebäudekomplexen bestand und die Kosten für jeden Teil gemäß HeizKVO getrennt abgerechnet wurden.
- Kompetenzdelegation an die Verwaltung (§ 27 Abs. 2 WEG)Die Eigentümergemeinschaft kann der Verwaltung bestimmte Entscheidungsbefugnisse übertragen, solange die Anweisungen ausreichend konkret sind und der Verwaltung keinen unbegrenzten Spielraum lassen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Beschluss zur Anwaltsbeauftragung war gültig, weil die Gemeinschaft die Auswahl der Kanzlei und die Vereinbarung des Stundenhonorars im Rahmen eines klaren Budgets an die Verwaltung delegieren durfte, ohne selbst einen Anwalt namentlich nennen oder Vergleichsangebote einholen zu müssen.
Das vorliegende Urteil
AG Hamburg-St. Georg – Az.: 980b C 3/25 WEG – Urteil vom 25.07.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.