Eine Vermieterin klagte auf Räumung wegen Mietrückständen und sprach eine neue Kündigung direkt in ihren digitalen Schriftsatz ein. Doch das Landgericht erklärte die Kündigung für unwirksam, weil sie den Mietern nicht „klar erkennbar“ zugestellt wurde.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Warum landete ein Streit um Mietrückstände vor dem Landgericht Krefeld?
- Wie versuchte die Vermieterin, das Mietverhältnis innerhalb der Klageschrift erneut zu kündigen?
- Weshalb argumentierten die Mieter, die Kündigung in der Klageschrift sei unwirksam?
- Unter welchen Voraussetzungen kann eine Kündigung in einem Gerichtsdokument die Schriftform ersetzen?
- Warum entschied das Landgericht Krefeld, dass die Kündigung nicht „klar erkennbar“ war?
- Welche Gegenargumente der Vermieterin wies das Gericht zurück?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was bedeutet ‚klar erkennbar‘ bei meiner elektronischen Kündigung?
- Kann ich meine Mietvertragskündigung direkt im Gerichtsschriftsatz erklären?
- Muss meine Kündigung im Schriftsatz immer klar erkennbar sein?
- Wie wird meine elektronisch signierte Kündigung rechtlich zugestellt?
- Was passiert, wenn meine Kündigung in einem digitalen Schriftsatz nicht auffällt?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 2 T 10/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Eine Vermieterin hatte hohe Mietrückstände bei ihren Mietern. Eine erste Kündigung war unwirksam, daher erklärte sie eine neue Kündigung direkt innerhalb ihrer Räumungsklage.
- Die Rechtsfrage: War diese im Klagedokument enthaltene Kündigung wirksam, obwohl sie nicht gesondert hervorgehoben war und nur als Papierausdruck zugestellt wurde?
- Die Antwort: Nein. Das Landgericht Krefeld entschied, dass die Kündigung nicht ausreichend klar erkennbar war. Wichtige Erklärungen müssen in einem langen Text sofort ins Auge fallen.
- Die Bedeutung: Wer eine wichtige Erklärung in einem Gerichtsdokument abgibt, muss diese unmissverständlich und deutlich sichtbar platzieren. Andernfalls ist die Erklärung nicht gültig.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Landgericht Krefeld
- Datum: 29.07.2025
- Aktenzeichen: 2 T 10/25
- Verfahren: Beschwerdeverfahren
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Zivilprozessrecht, Zivilrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Eine Vermieterin. Sie wollte die Mieter aus ihrer Wohnung räumen lassen.
- Beklagte: Mieter einer Wohnung. Sie sollten ihre Wohnung räumen.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Eine Vermieterin kündigte ihren Mietern wegen Zahlungsverzugs. Sie wollte die Kündigung durch eine Räumungsklage im Gerichtsschreiben zusätzlich bestätigen lassen.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Ist eine Mietkündigung gültig, wenn sie in einem elektronisch eingereichten gerichtlichen Schreiben enthalten ist, das den Mietern in Papierform zugestellt wurde und die Kündigung darin nicht besonders deutlich hervorgehoben war?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Kündigung im Klageschreiben war unwirksam.
- Zentrale Begründung: Die Kündigung war im Klageschreiben nicht deutlich genug als solche zu erkennen, obwohl das Schreiben elektronisch eingereicht wurde.
- Konsequenzen für die Parteien: Die Mieter müssen aufgrund dieser Kündigung nicht ausziehen, da sie vom Gericht als nicht wirksam betrachtet wurde.
Der Fall vor Gericht
Warum landete ein Streit um Mietrückstände vor dem Landgericht Krefeld?
Eine Vermieterin sah sich mit erheblichen Mietrückständen ihrer Mieter konfrontiert. Nachdem eine erste, außergerichtliche Kündigung vom September 2024 vom Amtsgericht für unwirksam erklärt wurde, weil die Begründung nicht ausreichte, reichte die Vermieterin am 13. Januar 2025 eine Räumungsklage ein.
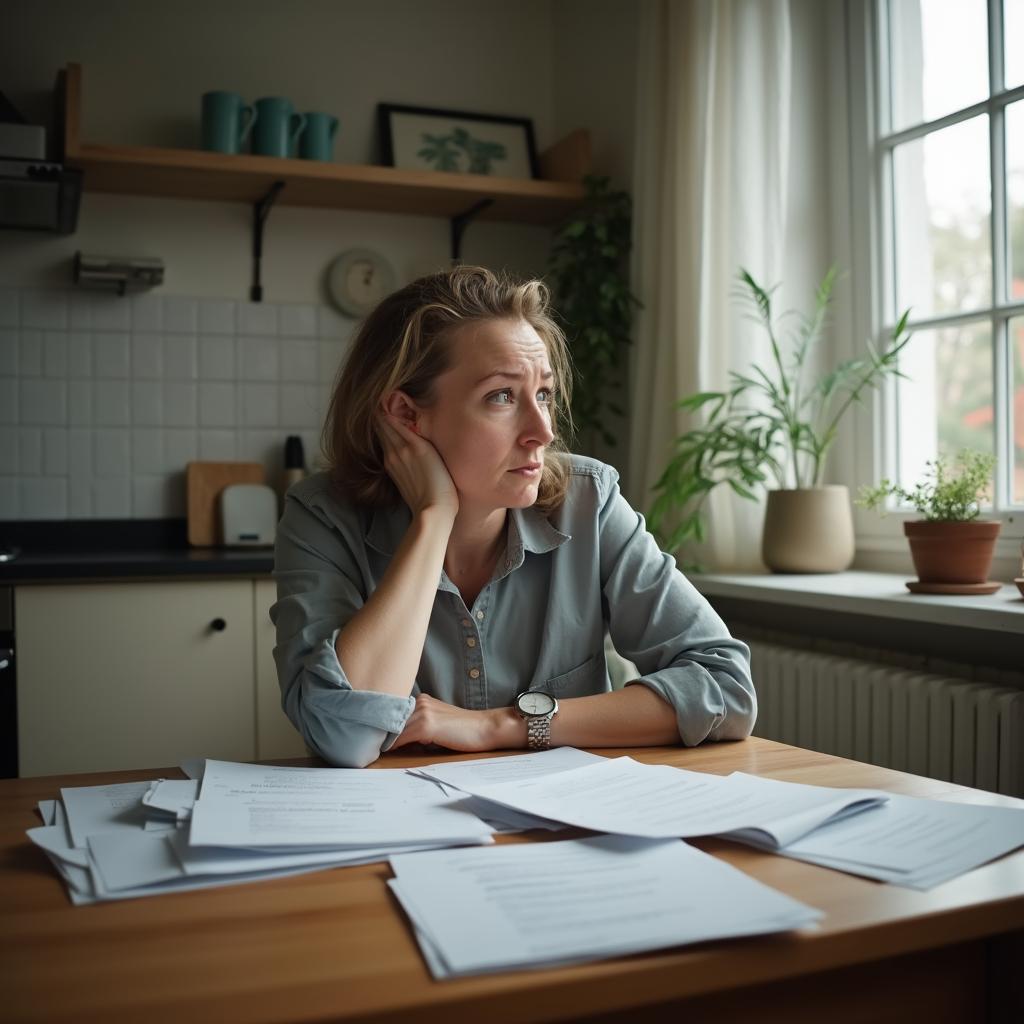
Ihr Ziel war es, die Mieter gerichtlich zum Auszug aus der Wohnung zu verpflichten. Die Klageschrift, also das Dokument, mit dem das Gerichtsverfahren eingeleitet wird, wurde von der Vermieterin digital beim Gericht eingereicht und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen – das ist die digitale Entsprechung einer handschriftlichen Unterschrift.
Wie versuchte die Vermieterin, das Mietverhältnis innerhalb der Klageschrift erneut zu kündigen?
In der Klageschrift erklärte die Vermieterin nicht nur, warum die vorherige Kündigung ihrer Meinung nach doch wirksam war. Sie baute zusätzlich eine neue Kündigungserklärung direkt in den Text der Klage ein. In einem Abschnitt mit der fettgedruckten Überschrift „3. Zahlungsverzug der Beklagten und Kündigung des Klägers“ listete sie die Mietschulden tabellarisch auf. Am Ende dieses Abschnitts, ohne besondere grafische Hervorhebung, stand der Satz:
„Aufgrund der hier aufgeführten Zahlungsrückstände (…) wird hiermit vorsorglich nochmals die fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses (…) erklärt und der Klageantrag hilfsweise auf die hiermit ausgesprochene Kündigung gestützt.“
Mit diesem Schachzug wollte die Vermieterin sicherstellen, dass das Mietverhältnis beendet wird, selbst wenn das Gericht die erste Kündigung für ungültig hält. Sie stützte ihre Räumungsklage also auf zwei Pfeiler: die alte Kündigung und die neue, direkt im Gerichtsdokument erklärte Kündigung.
Weshalb argumentierten die Mieter, die Kündigung in der Klageschrift sei unwirksam?
Die Mieter hielten diese zweite Kündigung für rechtlich unwirksam. Ihr zentrales Argument bezog sich auf die Formvorschriften. Eine Kündigung eines Wohnraummietvertrags muss laut Gesetz schriftlich erfolgen und dem Mieter im Original mit Unterschrift zugehen. Die digitale Alternative ist ein elektronisches Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur.
Die Mieter führten an, dass sie genau das nicht erhalten hatten. Ihnen wurde vom Gericht lediglich ein Papierausdruck der Klageschrift zugestellt. Ein solcher Ausdruck enthält aber nicht die digitale Signatur der Vermieterin. Er ist im Grunde nur eine Kopie. Auch der sogenannte Prüfvermerk, ein vom Gericht erstellter Vermerk, der bestätigt, dass das Dokument elektronisch eingereicht wurde, ersetzt die Signatur nicht.
Darüber hinaus machten die Mieter geltend, die Kündigungserklärung sei im Text der Klageschrift „versteckt“ gewesen. Sie war Teil eines langen Abschnitts, der sich hauptsächlich mit der Begründung der alten Kündigung befasste. Eine so wichtige Erklärung müsse aber deutlich hervorgehoben werden, um wirksam zu sein. Sie war nicht, wie sie argumentierten, „klar erkennbar“.
Unter welchen Voraussetzungen kann eine Kündigung in einem Gerichtsdokument die Schriftform ersetzen?
Hier kommt eine spezielle Vorschrift der Zivilprozessordnung ins Spiel: der § 130e ZPO. Diese Regelung soll die digitale Kommunikation mit den Gerichten erleichtern. Sie enthält eine sogenannte Formfiktion. Das bedeutet, das Gesetz tut so, als ob eine bestimmte Form eingehalten wurde, obwohl dies im klassischen Sinne nicht der Fall ist.
Man kann sich das wie einen zertifizierten digitalen Briefkasten vorstellen. Wenn eine Partei ein elektronisch signiertes Dokument beim Gericht einreicht und das Gericht dieses Dokument dem Gegner zustellt, dann fingiert § 130e ZPO zweierlei:
- Es wird so getan, als ob die Erklärung die gesetzliche Schriftform erfüllt.
- Es wird so getan, als ob die Erklärung dem Empfänger in dieser korrekten Form zugegangen ist.
Dieser juristische Kniff hat aber eine entscheidende Bedingung: Die Willenserklärung – hier die Kündigung – muss in dem Schriftsatz „klar erkennbar“ sein. Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, greift die Vereinfachung des Gesetzes. Der Streit drehte sich also im Kern um die Frage, was genau „klar erkennbar“ bedeutet.
Warum entschied das Landgericht Krefeld, dass die Kündigung nicht „klar erkennbar“ war?
Das Landgericht Krefeld folgte der Argumentation der Mieter und erklärte die in der Klageschrift enthaltene Kündigung für unwirksam. Die Richter bestätigten, dass die Vermieterin die Klage zwar formal korrekt elektronisch eingereicht und das Gericht sie den Mietern zugestellt hatte. Die wichtigste Hürde des § 130e ZPO wurde jedoch nicht genommen: die klare Erkennbarkeit.
Um den unbestimmten Rechtsbegriff „klar erkennbar“ mit Leben zu füllen, zog das Gericht einen Vergleich zum Verbraucherrecht. Dort müssen wichtige Informationen für Verbraucher, wie etwa eine Widerrufsbelehrung, so gestaltet sein, dass sie sofort ins Auge fallen. Übertragen auf diesen Fall bedeutet das: Eine Kündigung muss in einem langen juristischen Text so herausstechen, dass sie schon beim bloßen Durchblättern auffällt.
Mögliche Mittel zur Hervorhebung wären laut Gericht:
- Eine Platzierung ganz am Anfang des Dokuments
- Deutlicher Fettdruck der gesamten Kündigungserklärung
- Eine eigene, unmissverständliche Überschrift wie „Erklärung der Kündigung“
- Ein eigener Gliederungspunkt, der klar macht, dass hier eine neue, eigenständige Erklärung erfolgt
Im vorliegenden Fall reichte die Gestaltung nicht aus. Die Überschrift „3. Zahlungsverzug der Beklagten und Kündigung des Klägers“ war zu ungenau, da sie sich auch auf die bereits bekannte, alte Kündigung beziehen konnte. Der entscheidende Satz mit der neuen Kündigung stand unauffällig am Ende eines langen Textblocks. Er war zwar bei sorgfältigem Lesen auffindbar, aber nicht so platziert, dass er einem durchschnittlichen Empfänger ohne Weiteres auffallen musste. Da die Kündigung somit nicht „klar erkennbar“ war, griff die Formfiktion des § 130e ZPO nicht. Die Kündigung war daher unwirksam.
Welche Gegenargumente der Vermieterin wies das Gericht zurück?
Die Vermieterin brachte mehrere Argumente vor, um die Wirksamkeit ihrer Kündigung zu untermauern, doch das Gericht überzeugten diese nicht.
- Argument zum Prüfvermerk: Die Vermieterin meinte, der Prüfvermerk auf der zugestellten Papierkopie hätte die Mieter ausreichend über die elektronische Einreichung informiert. Das Gericht stellte klar, dass dieser Vermerk, wie auch der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, lediglich die Art der Einreichung dokumentiert. Er ersetzt aber niemals die fehlende Übermittlung der qualifizierten elektronischen Signatur selbst.
- Argument zur Beschränkung auf Arbeitsrecht: Die Vermieterin argumentierte, die strengen Anforderungen an die Erkennbarkeit seien nur für Kündigungen im Arbeitsrecht gedacht. Das Gericht widersprach. Der Wortlaut des § 130e ZPO sei allgemein gehalten und mache keine solche Einschränkung. Die Regel gilt für alle formbedürftigen Erklärungen, also auch für mietrechtliche Kündigungen.
- Argument der nachträglichen Heilung: Die Idee, dass ein Mangel durch einen späteren Hinweis des Gerichts oder der Partei geheilt werden könnte, verwarf das Gericht. Formvorschriften sind streng. Eine von Anfang an formunwirksame Erklärung kann nicht rückwirkend gültig werden, nur weil man später darauf hinweist.
Das Gericht hielt an seiner strengen Auslegung fest. Der Zweck des Gesetzes, die Digitalisierung zu fördern, darf nicht den Schutz des Empfängers aushöhlen. Wer eine wichtige Erklärung wie eine Kündigung in einem langen Dokument abgeben will, muss dafür sorgen, dass sie unübersehbar ist. Da die Kündigung in der Klageschrift diese Anforderung nicht erfüllte, blieb der ursprüngliche Beschluss des Amtsgerichts bestehen: Die Räumungsklage hatte keine wirksame Grundlage.
Die Urteilslogik
Wer wichtige Erklärungen in digitalen Gerichtsverfahren abgibt, muss deren sofortige Erkennbarkeit sicherstellen.
- Klarheit ist entscheidend für digitale Rechtserklärungen: Eine in einem elektronischen Gerichts Schriftsatz enthaltene rechtliche Erklärung muss für den Empfänger sofort und unmissverständlich erkennbar sein, damit sie Rechtswirksamkeit entfaltet.
- Formvorschriften sind streng und nicht nachträglich heilbar: Formbedürftige Willenserklärungen müssen von Anfang an den gesetzlichen Anforderungen genügen; spätere Hinweise oder Erläuterungen können Mängel nicht rückwirkend beheben.
- Prüfvermerke ersetzen keine Signatur oder Erkennbarkeit: Gerichtliche Prüfvermerke dokumentieren lediglich die Einreichung, ersetzen aber niemals die qualifizierte elektronische Signatur einer formbedürftigen Erklärung oder deren klare Erkennbarkeit auf einem zugestellten Ausdruck.
Die Rechtsprechung unterstreicht, dass die digitale Justiz zwar Verfahren vereinfacht, jedoch die Anforderungen an die unmissverständliche Gestaltung wichtiger Willenserklärungen beibehält.
Benötigen Sie Hilfe?
Stehen Sie vor Fragen zur Wirksamkeit einer Kündigung im Klageschreiben? Erhalten Sie eine professionelle Einschätzung Ihres Anliegens.
Das Urteil in der Praxis
Was auf den ersten Blick wie ein technischer Winkelzug aussieht, entpuppt sich als mahnendes Beispiel für die Sorgfalt im digitalen Rechtsverkehr. Das Landgericht Krefeld stellt unmissverständlich klar: Wer wichtige Erklärungen wie eine Kündigung in einem Schriftsatz versteckt, spielt mit dem Feuer. Die digitale Formfiktion des § 130e ZPO greift nur, wenn die Erklärung auch wirklich „klar erkennbar“ ist – und das bedeutet für die Praxis mehr als nur ein unscheinbarer Satz am Ende eines langen Textes. Dieses Urteil ist ein Weckruf für jeden, der wichtige Botschaften digital übermittelt: Machen Sie sie unübersehbar, sonst verpuffen sie wirkungslos.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet ‚klar erkennbar‘ bei meiner elektronischen Kündigung?
Eine elektronische Kündigung muss in digitalen Dokumenten so gestaltet sein, dass sie sofort ins Auge springt und für den Empfänger unmissverständlich als eigenständige Willenserklärung klar erkennbar ist. Das Landgericht Krefeld verlangt hier eine deutliche Hervorhebung, um zu verhindern, dass solch wichtige Informationen in langen Texten „versteckt“ werden. Fehlt diese Erkennbarkeit, ist die Kündigung unwirksam.
Juristen nennen das eine Formfiktion nach § 130e ZPO. Diese Vorschrift erlaubt, dass eine elektronisch signierte Erklärung, die über das Gericht zugestellt wird, als formgerecht gilt – als sei sie handschriftlich unterzeichnet. Der Haken? Diese Erleichterung greift nur, wenn die Willenserklärung „klar erkennbar“ ist. Empfänger sollen nicht überrumpelt werden. Gerichte verlangen, dass wichtige Erklärungen nicht im Kleingedruckten untergehen.
Das Landgericht Krefeld machte klare Vorgaben. Eine Vermieterin versuchte, eine Kündigung unauffällig in einer längeren Klageschrift zu platzieren. Die Überschrift war zu vage, der entscheidende Satz stand unauffällig am Ende eines Textblocks. Trotz sorgfältigen Lesens wäre sie kaum aufgefallen. Gerichte fordern für die klare Erkennbarkeit deutlichen Fettdruck, eine eigene, unmissverständliche Überschrift oder eine Platzierung ganz am Anfang des Dokuments. Ein bloßes „Auffindbar-Sein“ durch intensives Suchen reicht nicht. Wer digital kündigt oder andere formbedürftige Erklärungen in komplexen Dokumenten abgibt, muss diese unübersehbar gestalten.
Eine versteckte Kündigung? Teuer. Achten Sie bei der elektronischen Kündigung stets auf unmissverständliche Gestaltung und Hervorhebung.
Kann ich meine Mietvertragskündigung direkt im Gerichtsschriftsatz erklären?
Ja, grundsätzlich kann eine Mietvertragskündigung in einem Gerichtsschriftsatz erklärt werden, ABER sie muss für den Empfänger klar erkennbar sein. Juristen nennen das die Formfiktion nach § 130e ZPO. Ist die Kündigung im Text versteckt, nützt auch die elektronische Einreichung beim Gericht nichts; sie bleibt unwirksam. Das Landgericht Krefeld erteilte hier eine klare Absage.
Der Grund: Eine Kündigung verlangt nach dem Gesetz die Schriftform. Man unterschreibt ein Original, oder man nutzt die qualifizierte elektronische Signatur für digitale Dokumente. Der § 130e ZPO erleichtert das, indem er eine „Formfiktion“ schafft: Reichen Sie ein korrekt signiertes elektronisches Dokument beim Gericht ein und das Gericht stellt es dem Gegner zu, wird so getan, als wäre die Form eingehalten. Das ist ein juristischer Kniff, der die digitale Kommunikation fördern soll.
Doch dieser Kniff greift nur, wenn die Kündigung im Schriftsatz „klar erkennbar“ ist. Das Landgericht Krefeld zeigte, wie ernst Gerichte diese Hürde nehmen. Eine Vermieterin wollte Mieter wegen Rückständen räumen. Ihre neue Kündigung setzte sie unauffällig ans Ende eines langen Abschnitts der Klageschrift, ohne spezielle Hervorhebung. Eine unscheinbare Überschrift über den Zahlungsverzug reichte den Richtern nicht. Sie verglichen dies mit Verbraucherrecht: Wichtige Erklärungen, wie ein Widerruf, müssen sofort ins Auge springen. Eine Platzierung am Anfang, Fettdruck oder eine eigene Überschrift wie „Erklärung der Kündigung“ wären nötig gewesen.
Wer also eine Mietvertragskündigung im Gerichtsdokument wirksam erklären will, muss sie unübersehbar gestalten.
Muss meine Kündigung im Schriftsatz immer klar erkennbar sein?
Ja, eine Kündigung im Schriftsatz muss zwingend klar erkennbar sein, damit sie ihre volle Rechtswirkung entfaltet. Besonders bei digitaler Einreichung über § 130e ZPO ist diese Anforderung entscheidend. Fehlt die deutliche Hervorhebung, wird die Erklärung als unwirksam angesehen, selbst wenn sie formal korrekt übermittelt wurde. Dies schützt den Empfänger davor, wichtige rechtliche Schritte zu übersehen.
Juristen nennen das eine „Formfiktion“. Das Gesetz tut so, als ob die Schriftform eingehalten ist, sobald ein elektronisch signiertes Dokument vom Gericht zugestellt wird. Dieser Kniff funktioniert aber nur unter einer Bedingung: Die Kündigung im Schriftsatz muss für den Empfänger unmissverständlich hervortreten. Der Grund? Eine so einschneidende Erklärung muss sofort ins Auge springen, damit Adressaten ihre Rechte wahrnehmen können. Es geht um Transparenz und Rechtssicherheit für alle Beteiligten.
Das Landgericht Krefeld erteilte einer Vermieterin in einem solchen Fall eine klare Absage. Sie hatte eine Kündigung unauffällig am Ende eines langen Textabschnitts in ihrer Räumungsklage platziert. Die Überschrift war zu vage, die Kündigung selbst nicht fett gedruckt, kein eigener Gliederungspunkt war vorhanden. Richter forderten: Eine Kündigung gehört ganz nach vorn im Dokument, muss mit einer unmissverständlichen Überschrift wie „Erklärung der Kündigung“ glänzen oder komplett fett gedruckt sein. Sie muss beim bloßen Durchblättern auffallen. Ohne diese Deutlichkeit blieb die Kündigung unwirksam.
Wer eine Kündigung in einem Gerichtsdokument erklärt, muss diese unübersehbar gestalten, sonst droht der Rechtsstreit ins Leere zu laufen.
Wie wird meine elektronisch signierte Kündigung rechtlich zugestellt?
Eine elektronisch signierte Kündigung gilt als rechtlich zugestellt, sobald das Gericht das digital eingereichte Dokument an den Gegner übermittelt hat – vorausgesetzt, es ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und die Kündigungserklärung ist im Schriftsatz „klar erkennbar“. Die Zustellung durch das Gericht ersetzt in diesem Fall die klassische Schriftform.
Die Regel dafür liefert der § 130e ZPO. Juristen nennen das eine Formfiktion: Das Gesetz tut so, als ob die Willenserklärung die Schriftform einhält und dem Empfänger korrekt zuging, obwohl er vielleicht nur einen Papierausdruck erhält. Dieser Kniff erleichtert die digitale Kommunikation mit Gerichten erheblich, doch er hat eine entscheidende Bedingung.
Ihre Kündigung muss im elektronischen Dokument unübersehbar sein. Das Landgericht Krefeld machte klare Vorgaben: Eine Kündigung, die in einem langen Schriftsatz versteckt ist, zählt nicht. Sie muss schon beim Überfliegen ins Auge springen. Eine eigene, prägnante Überschrift wie „Kündigungserklärung“, deutlicher Fettdruck oder eine Platzierung am Anfang des Dokuments sind Pflicht. Andernfalls ist die Kündigung unwirksam.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre elektronisch signierte Kündigung im Gerichtsdokument nicht zur digitalen Stolperfalle wird.
Was passiert, wenn meine Kündigung in einem digitalen Schriftsatz nicht auffällt?
Eine Kündigung in einem digitalen Schriftsatz, die nicht klar erkennbar ist, bleibt unwirksam. Das Gesetz (§ 130e ZPO) verlangt, dass solche wichtigen Erklärungen sofort ins Auge fallen, selbst wenn die technische Form gewahrt ist. Gerichte werten jede „versteckte“ Kündigung als ungültig, mit weitreichenden Folgen für den Absender.
Die Regelung des § 130e ZPO ermöglicht zwar die digitale Übermittlung von Dokumenten, knüpft daran aber eine entscheidende Bedingung: Empfänger sollen nicht nach einer Kündigung suchen müssen. Eine Willenserklärung muss „klar erkennbar“ sein, sonst greift die sogenannte Formfiktion nicht.
Das Landgericht Krefeld entschied genau in diesem Sinne: Eine Vermieterin versteckte eine neue Kündigung am Ende eines langen Abschnitts über Mietrückstände. Obwohl die Klageschrift elektronisch signiert war, bemängelte das Gericht die mangelnde Hervorhebung. Eine Kündigung braucht klare Überschriften, deutlichen Fettdruck der gesamten Erklärung oder eine Platzierung ganz am Anfang. War sie unauffällig platziert? Das wird teuer.
Wer eine Kündigung digital zustellen will, muss für unübersehbare Klarheit sorgen, sonst ist die Mühe umsonst.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Formfiktion
Eine Formfiktion beschreibt einen juristischen Kniff, bei dem das Gesetz so tut, als sei eine bestimmte Formvorschrift erfüllt, obwohl sie im klassischen Sinne nicht eingehalten wurde. Der Gesetzgeber schafft diese Annahme, um Prozesse zu vereinfachen oder die Rechtspraxis an neue Gegebenheiten anzupassen, ohne die Schutzziele der Formvorschrift zu opfern.
Beispiel: Nach § 130e ZPO wird fingiert, dass eine elektronisch eingereichte Kündigung die Schriftform erfüllt hat, selbst wenn der Empfänger nur einen Ausdruck erhält, sofern sie klar erkennbar war.
Klar erkennbar
Die Anforderung „klar erkennbar“ bedeutet, dass eine rechtlich bedeutsame Erklärung in einem Dokument so gestaltet und platziert sein muss, dass sie für den Empfänger ohne weiteres Nachdenken und Suchen sofort ins Auge springt. Juristen legen Wert darauf, dass wichtige Informationen nicht im Kleingedruckten untergehen, damit der Adressat seine Rechte wahrnehmen kann.
Beispiel: Das Landgericht Krefeld entschied, dass eine im Fließtext einer Klageschrift versteckte Kündigung nicht klar erkennbar war, da sie weder durch Fettdruck noch eine eigene Überschrift hervorgehoben wurde.
Prüfvermerk
Ein Prüfvermerk ist ein vom Gericht erstellter Hinweis, der auf einer zugestellten Papierkopie eines elektronisch eingereichten Dokuments erscheint und die erfolgreiche Übermittlung bestätigt. Dieser Vermerk dient lediglich der Dokumentation des digitalen Einreichungswegs und ersetzt niemals eine erforderliche qualifizierte elektronische Signatur oder deren Übermittlung.
Beispiel: Obwohl die Mieter einen Prüfvermerk auf ihrer Papierkopie der Klageschrift hatten, argumentierten sie erfolgreich, dass dieser die fehlende qualifizierte elektronische Signatur der Vermieterin nicht ersetzen konnte.
Qualifizierte elektronische Signatur (QES)
Eine Qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist die höchste Stufe der digitalen Unterschrift und gilt rechtlich als gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift. Sie bietet höchste Beweiskraft, da sie die Identität des Unterzeichners zweifelsfrei bestätigt und die Unverfälschtheit des Dokuments nach der Signatur gewährleistet.
Beispiel: Die Vermieterin hatte ihre Räumungsklage mit einer Qualifizierten elektronischen Signatur versehen, die aber den Mietern nicht in ihrer digitalen Form zuging, sondern nur als Papierausdruck ohne die digitale Signatur.
§ 130e ZPO
Der § 130e ZPO ist eine zentrale Vorschrift in der Zivilprozessordnung, die regelt, unter welchen Bedingungen elektronisch eingereichte Dokumente die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform ersetzen. Diese Norm fördert die Digitalisierung des Rechtsverkehrs, indem sie eine Formfiktion für elektronische Schriftsätze schafft, wenn diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und vom Gericht an den Empfänger zugestellt werden.
Beispiel: Das Landgericht Krefeld prüfte genau, ob die Voraussetzungen des § 130e ZPO für die Kündigung in der Klageschrift erfüllt waren, kam aber zum Schluss, dass die Kündigung nicht klar erkennbar gewesen war.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Elektronische Einreichung von Dokumenten vor Gericht und die Formfiktion (§ 130e Zivilprozessordnung)
Diese Vorschrift ermöglicht es, juristische Dokumente elektronisch beim Gericht einzureichen und unter bestimmten Umständen die gesetzliche Schriftform zu ersetzen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Vermieterin nutzte diese Möglichkeit, um ihre Räumungsklage und die darin enthaltene Kündigung digital einzureichen, wobei der Streitpunkt war, ob die Kündigung im Dokument „klar erkennbar“ war, damit die Formfiktion greift.
- Schriftformerfordernis bei der Kündigung von Mietverträgen (§ 568 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch)
Die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses muss immer schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Da die Kündigung der Vermieterin die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform erfüllen musste, war entscheidend, ob die Einreichung über § 130e ZPO diese Anforderung korrekt simulierte.
- Grundsatz der Klarheit und Erkennbarkeit von Willenserklärungen
Wichtige rechtliche Erklärungen müssen für den Empfänger so gestaltet sein, dass sie sofort und unmissverständlich erkennbar sind.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht legte diesen Grundsatz zur Auslegung des Begriffs „klar erkennbar“ in § 130e ZPO heran und entschied, dass die Kündigung, da sie im langen Text „versteckt“ war, diese Anforderung nicht erfüllte.
- Grundsatz der Formstrenge und Nichtheilbarkeit von Formmängeln
Gesetzliche Formvorschriften sind strikt einzuhalten, und ein anfänglicher Mangel in der Form kann in der Regel nicht nachträglich geheilt werden.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht wies die Argumente der Vermieterin zurück, wonach die Kündigung nachträglich geheilt werden könnte, da die Formvorschrift der klaren Erkennbarkeit von Anfang an nicht erfüllt war.
Das vorliegende Urteil
LG Krefeld – Az.: 2 T 10/25 – Beschluss vom 29.07.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









