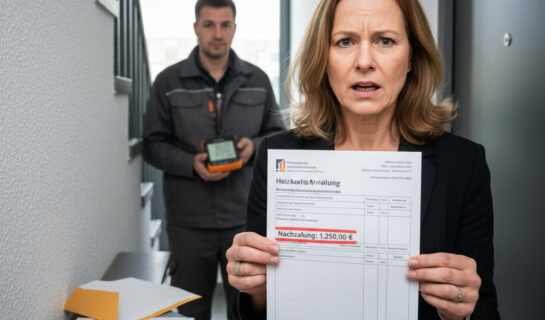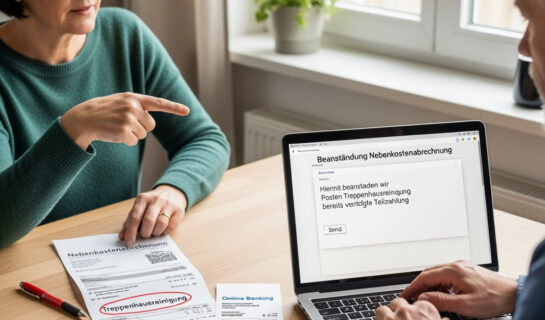Ein älterer Mann fand sich nach jahrelanger Bewohnung plötzlich vor der verschlossenen Tür seiner Wohnung wieder, sein gesamtes Hab und Gut bereits geräumt. Er pochte darauf, er habe mit seiner Nichte einen mündlichen Mietvertrag über 900 Euro monatlich für die 76 Quadratmeter große Wohnung geschlossen und stets gezahlt. Doch die Eigentümerin bestritt jeglichen mündlichen Mietvertrag vehement und beharrte darauf, die Nutzung sei lediglich eine kostenlose, längst beendete Leihe gewesen. Der Mann forderte nun die Wiedereinräumung des Besitzes, während die Nichte ihrerseits die sofortige Räumung der Wohnung verlangte.
Übersicht
- Das Urteil in 30 Sekunden
- Die Fakten im Blick
- Der Fall vor Gericht
- Eine verschlossene Tür und eine brisante Familienangelegenheit – Wer darf in die Wohnung?
- Was genau stritten Onkel und Nichte vor Gericht?
- Welche rechtliche Hürde musste das Gericht zunächst nehmen?
- Musste das Gericht überhaupt entscheiden, ob es Miete oder Leihe war?
- Warum zweifelte das Gericht an den Mietzahlungen des Onkels?
- Was entschied das Gericht am Ende?
- Die Urteilslogik
- Benötigen Sie Hilfe?
- Das Urteil in der Praxis
- Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Mietvertrag und einem Leihvertrag im Kontext der Immobiliennutzung?
- Unter welchen Voraussetzungen kann ein Eigentümer die Herausgabe einer von ihm überlassenen Sache zurückfordern?
- Warum ist die Dokumentation von Zahlungen und Vereinbarungen bei mündlichen Abmachungen so entscheidend?
- Welche Herausforderungen können bei der Überlassung von Wohnraum an Familienangehörige ohne schriftlichen Vertrag entstehen?
- Wann erlischt das Recht einer Person, eine überlassene Sache weiter zu besitzen?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 12 C 11/25 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Urteil in 30 Sekunden
- Das Problem: Ein älterer Mann wurde aus einer Wohnung ausgesperrt, die seiner Nichte gehört. Er behauptete, er habe dort mit Mietvertrag gewohnt. Die Nichte sagte, er habe die Wohnung nur geliehen.
- Die Frage: Hatte der Mann ein gültiges Recht, die Wohnung weiter zu nutzen?
- Die Antwort: Nein. Das Gericht glaubte dem Mann nicht, dass er Miete gezahlt hatte. Ohne Mietzahlungen hatte er kein Recht mehr, die Wohnung zu behalten.
- Das bedeutet das für Sie: Ohne klare Beweise für regelmäßige Zahlungen kann ein mündlicher Mietvertrag schnell ungültig werden. Der Mann muss die Wohnung räumen.
Die Fakten im Blick
- Gericht: Amtsgericht Bottrop
- Datum: 05.05.2025
- Aktenzeichen: 12 C 11/25
- Verfahren: Zivilprozess
- Rechtsbereiche: Mietrecht, Sachenrecht, Zivilprozessrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Der Onkel der Beklagten. Er wollte den Besitz an einer Wohnung zurückbekommen.
- Beklagte: Die Nichte des Klägers und Eigentümerin der Wohnung. Sie forderte die Räumung der Wohnung.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Der Kläger wohnte in einer Wohnung der Beklagten. Die Beklagte verwehrte ihm den Zugang zur Wohnung und räumte diese.
- Kernfrage: Hatte der Onkel (Kläger) noch das Recht, in der Wohnung seiner Nichte (Beklagte) zu wohnen, oder musste er die Wohnung räumen?
Entscheidung des Gerichts:
- Urteil im Ergebnis: Die Klage des Klägers wurde abgewiesen; die Widerklage der Beklagten auf Räumung wurde stattgegeben.
- Zentrale Begründung: Das Gericht entschied, dass das Recht des Klägers, die Wohnung zu besitzen, erloschen war, weil die Beklagte das Nutzungsverhältnis wirksam gekündigt hatte, insbesondere da der Kläger seine behaupteten Mietzahlungen nicht glaubhaft machen konnte.
- Konsequenzen für die Parteien: Der Kläger erhält den Besitz an der Wohnung nicht zurück, muss die Wohnung räumen und alle Prozesskosten tragen.
Der Fall vor Gericht
Eine verschlossene Tür und eine brisante Familienangelegenheit – Wer darf in die Wohnung?
Die Geschichte, die das Amtsgericht in einer norddeutschen Großstadt beschäftigte, begann mit einer verschlossenen Tür und einer tiefen Kluft zwischen Familienmitgliedern. Ein älterer Mann, der jahrelang in einer Wohnung gewohnt hatte, die seiner Nichte gehörte, fand sich plötzlich ausgesperrt. Sein gesamtes Hab und Gut war aus der Wohnung geräumt worden. Für den früheren Bewohner war klar: Er hatte einen Mietvertrag, zahlte Miete und hatte ein Recht, in seine Wohnung zurückzukehren. Doch seine Nichte sah das völlig anders. Für sie hatte der Onkel die Wohnung lediglich geliehen bekommen, und dieses Leihverhältnis hatte sie längst beendet. Wer hatte nun Recht, und durfte der Onkel den Besitz an der Wohnung zurückfordern?
Was genau stritten Onkel und Nichte vor Gericht?

Der frühere Bewohner, der Kläger in diesem Fall, trat vor Gericht mit der Forderung, ihm den Besitz an der etwa 76 Quadratmeter großen Wohnung wieder einzuräumen. Er behauptete, er habe mit seiner Nichte, der Eigentümerin der Wohnung, einen mündlichen Mietvertrag geschlossen. Monatlich habe er pauschal 900 Euro gezahlt, inklusive Strom, Heizung und aller Nebenkosten. Dieses Geld habe er stets pünktlich entrichtet, und daraus leite er sein unbestreitbares Recht ab, in der Wohnung zu leben.
Die Nichte, die als Beklagte vor Gericht stand, bestritt vehement, jemals einen Mietvertrag mit ihrem Onkel abgeschlossen zu haben. Ihre Version der Geschichte war, dass sie ihrem Onkel die Wohnung lediglich zur Nutzung überlassen hatte – und zwar unentgeltlich, also als sogenannte Leihe. Sie trug vor, sie habe ihren Onkel bereits Monate zuvor aufgefordert, die Wohnung bis Ende November zu räumen. Zudem habe sie ihn mehrfach aufgerufenen, Müll in der Wohnung zu beseitigen. Am Ende habe der Onkel sogar selbst seinen Wohnungsschlüssel in ihren Briefkasten geworfen. Da sie das Nutzungsverhältnis in ihren Augen ordnungsgemäß gekündigt hatte, verlangte sie nun, dass die Klage ihres Onkels abgewiesen werde. Gleichzeitig forderte sie im Rahmen einer eigenen Gegenklage die Räumung der Wohnung und die Herausgabe durch den Onkel. Für den Fall, dass das Gericht doch einen Mietvertrag annehmen sollte, forderte sie hilfsweise 27.000 Euro an ausstehenden Mietzahlungen – ein Betrag, den der Onkel natürlich bestritt.
Welche rechtliche Hürde musste das Gericht zunächst nehmen?
Die Kernfrage für das Gericht war also: Bestand ein Mietvertrag oder ein Leihvertrag? Und falls ja, war das Recht des Onkels, die Wohnung zu besitzen, mittlerweile erloschen? Das Gericht hatte die Aufgabe, diesen Knoten zu entwirren. Dabei stützte es sich auf einige grundlegende Pfeiler des Zivilrechts.
Ein wichtiger Gedanke ist hier der sogenannte Herausgabeanspruch des Eigentümers: Wer Eigentümer einer Sache ist, kann diese grundsätzlich vom Besitzer zurückfordern, es sei denn, der Besitzer hat ein eigenes Recht, die Sache zu behalten. Der Onkel hatte die Wohnung unstreitig besessen, und die Nichte war unstreitig die Eigentümerin. Der Streit drehte sich also allein darum, ob der Onkel ein fortbestehendes Recht hatte, die Wohnung weiter zu nutzen.
Ein Mietvertrag, wie ihn der Onkel behauptete, würde dem Mieter ein solches Recht einräumen – und das gegen eine regelmäßige Zahlung. Ein Leihvertrag hingegen würde die Nutzung unentgeltlich gestatten. Der wesentliche Unterschied: Bei einer Leihe kann der Verleiher die geliehene Sache in der Regel jederzeit zurückfordern, wenn keine bestimmte Dauer vereinbart wurde. Bei einem Mietvertrag ist das viel schwieriger; hier braucht es einen triftigen Grund für eine Kündigung, zum Beispiel, wenn der Mieter seine Zahlungen nicht leistet.
Das Gericht stand vor der Herausforderung, zu beurteilen, welche der beiden Versionen glaubhaft war. Dafür hörte es sowohl den Onkel als auch die Nichte persönlich an und zog zusätzlich Akten eines anderen Gerichtsverfahrens bei, das zwischen den beiden Parteien lief.
Musste das Gericht überhaupt entscheiden, ob es Miete oder Leihe war?
Erstaunlicherweise entschied das Gericht, dass es die Frage, ob ein Mietvertrag oder ein Leihvertrag vorlag, nicht abschließend klären musste. Der Grund dafür ist ein besonderer juristischer Kniff, der zur Anwendung kommt, wenn die Frage nach dem Recht zum Besitz und die Klage auf Herausgabe gleichzeitig vor Gericht behandelt werden. Vereinfacht gesagt: Wenn sich herausstellt, dass derjenige, der die Sache beansprucht, ohnehin ein Recht hat, sie zurückzufordern – hier die Nichte als Eigentümerin – dann erlischt der ursprüngliche Anspruch des Besitzers, die Sache zurückzubekommen oder zu behalten.
Das Gericht argumentierte, dass das ursprüngliche Recht des Onkels, die Wohnung zu nutzen – sei es aus einem Mietvertrag oder einem Leihvertrag – spätestens durch die Kündigung der Nichte erloschen war.
- Wenn es ein Leihvertrag gewesen wäre: Da die Dauer der Leihe nicht explizit bestimmt war, hätte die Nichte als Verleiherin die Wohnung jederzeit zurückfordern können. Ihre Kündigung hätte den Leihvertrag sofort beendet.
- Wenn es ein Mietvertrag gewesen wäre: Auch hier wäre das Nutzungsrecht des Onkels erloschen. Denn selbst wenn es einen Mietvertrag gegeben hätte, wäre die Nichte berechtigt gewesen, diesen fristlos zu kündigen. Der entscheidende Grund dafür: Der Onkel hatte nach Überzeugung des Gerichts seine angebliche monatliche Mietzahlungspflicht nicht schlüssig dargelegt.
Die Klage des Onkels auf Wiedereinräumung des Besitzes war somit unbegründet, weil gleichzeitig die Gegenklage der Nichte auf Räumung und Herausgabe der Wohnung erfolgreich war. Die Nichte hatte das unstreitige Eigentum an der Wohnung, und der Onkel hatte kein Recht mehr, diese zu besitzen.
Warum zweifelte das Gericht an den Mietzahlungen des Onkels?
Der Knackpunkt in der Argumentation des Gerichts war die fehlende Glaubwürdigkeit der Behauptung des Onkels, er habe tatsächlich monatlich 900 Euro Miete gezahlt. Das Gericht stützte sich dabei auf eine detaillierte Analyse der finanziellen Situation des Onkels, die es aus seinen eigenen Angaben bei der persönlichen Anhörung und aus eingereichten Kontoauszügen gewann:
- Der Onkel gab an, monatlich 1.276 Euro netto zu verdienen (davon 1. Fitnessstudio abgezogen.
- Wären nun noch 900 Euro für die Miete hinzugekommen, wären dem Onkel monatlich weniger als 200 Euro für Lebensmittel und andere persönliche Ausgaben verblieben. Dies erschien dem Gericht als höchst unglaubwürdig.
- Zudem zeigten die vorgelegten Lohnabrechnungen des Onkels, dass er teilweise sogar nur etwa 890 Euro monatlich verdiente – ein Betrag, der schon unter der angeblich gezahlten Miete lag. Die Erklärung des Onkels, er habe in „guten“ Monaten gespart, um „schlechte“ Monate auszugleichen, konnte das Gericht angesichts der geringen Beträge nicht überzeugen.
- Besonders kritisch sah das Gericht die Behauptung des Onkels, er habe einen Teil der Miete von seinem Konto abgehoben und den Rest voneten 900 Euro Miete zu zahlen, hätte er also weitere 400 Euro aufbringen müssen. Dies hätte er aus den 276 Euro vom Arbeitgeber und weiteren, angesparten Rücklagen bestreiten müssen. Doch diese Erklärung war für das Gericht nicht glaubhaft, zumal die 276 Euro vom Arbeitgeber auch für notwendige Lebenshaltungskosten wie Lebensmittel aufgewendet werden mussten, wofür ebenfalls keine Abbuchungen auf den Kontoauszügen zu finden waren.
Aufgrund dieser detaillierten finanziellen Überprüfung war das Gericht nicht davon überzeugt, dass ein wirksamer Mietvertrag, insbesondere mit regelmäßigen Mietzahlungen, tatsächlich zwischen Onkel und Nichte geschlossen worden war.
Was entschied das Gericht am Ende?
Das Gericht wies die Klage des Onkels, ihm den Besitz an der Wohnung wieder einzuräumen, vollständig ab. Stattdessen gab es der Gegenklage der Nichte statt: Der Onkel wurde verurteilt, die fragliche Wohnung in geräumtem Zustand an die Nichte herauszugeben. Die weitere Zahlungsforderung der Nichte in Höhe von 27.000 Euro für angebliche Mietrückstände wurde vom Gericht nicht behandelt, da die Bedingung dafür – nämlich dass überhaupt ein Mietvertrag bestanden haben müsste – nach Überzeugung des Gerichts nicht eingetreten war. Die Kosten des gesamten Rechtsstreits musste der Onkel tragen, da er mit seiner Klage unterlegen war. Das Urteil bezüglich der Räumung und Herausgabe der Wohnung ist vorläufig vollstreckbar, was bedeutet, dass die Nichte es umsetzen kann, auch wenn der Onkel noch Rechtsmittel einlegen sollte.
Die Urteilslogik
Das Eigentum bietet den stärksten Schutz und ermöglicht die Rückforderung einer Sache, wenn kein gültiges Nutzungsrecht besteht.
- Eigentum setzt sich durch: Ein Eigentümer fordert seine Sache erfolgreich zurück, sofern der aktuelle Besitzer kein fortbestehendes, eigenständiges Recht zum Besitz nachweisen kann.
- Rechtsgrundlage kann unwesentlich sein: Gerichte klären die genaue vertragliche Grundlage einer Nutzung nicht zwingend, wenn das Recht zur Nutzung unter allen möglichen Bedingungen erlischt.
- Behauptungen brauchen Glaubwürdigkeit: Wer Zahlungen oder andere vertragliche Verpflichtungen behauptet, muss diese plausibel darlegen, da das Gericht Widersprüche sorgfältig prüft.
Eine umfassende Prüfung der Faktenlage, insbesondere finanzieller Angaben, entscheidet über die Durchsetzbarkeit von Besitzansprüchen.
Benötigen Sie Hilfe?
Wird Ihr mündlich vereinbartes Wohnrecht plötzlich bestritten oder gekündigt? Wir geben Ihnen eine erste Orientierung: Nutzen Sie unsere unverbindliche Ersteinschätzung.
Das Urteil in der Praxis
Für jeden, der meint, eine Handschlag-Vereinbarung reiche unter Verwandten aus, hält dieses Urteil eine harte Lektion bereit. Es zeigt gnadenlos auf, wie entscheidend die lückenlose und plausible Nachweisbarkeit von Zahlungsströmen ist, selbst wenn das Gericht die genaue Vertragsart offenlässt. Die detaillierte finanzielle Prüfung des Gerichts entlarvte hier die angebliche Mietzahlung als unglaubwürdig und entzog dem Anspruch des Onkels den Boden. Wer sich auf mündliche Vereinbarungen – insbesondere bei hohen Beträgen – verlässt, riskiert im Streitfall einen Totalverlust und steht schnell mit leeren Händen da.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Mietvertrag und einem Leihvertrag im Kontext der Immobiliennutzung?
Der wesentliche Unterschied zwischen einem Mietvertrag und einem Leihvertrag im Kontext der Immobiliennutzung liegt in der Entgeltlichkeit der Überlassung. Ein Mietvertrag erfordert eine regelmäßige Zahlung für die Nutzung einer Sache, während eine Leihe die Überlassung unentgeltlich gestattet.
Stellen Sie sich vor, Sie nutzen ein Auto: Wenn Sie dafür Geld bezahlen, ist es wie eine Miete; wenn Ihnen ein Freund es kostenlos überlässt, ist es wie eine Leihe.
Dieser fundamentale Unterschied hat weitreichende Konsequenzen für die Dauer und Beendigung des Nutzungsrechts. Bei einem Mietvertrag, insbesondere für Wohnraum, genießt der Mieter in der Regel einen umfassenden Kündigungsschutz. Das bedeutet, der Vermieter kann den Vertrag nur unter bestimmten, gesetzlich festgelegten Bedingungen beenden, zum Beispiel bei wiederholter Nichtzahlung der Miete.
Im Gegensatz dazu ist ein Leihvertrag viel flexibler für den Eigentümer. Wurde keine feste Dauer für die Leihe vereinbart, kann der Verleiher die geliehene Sache in der Regel jederzeit zurückfordern.
Diese klare Unterscheidung schützt die Rechte und Pflichten beider Parteien und schafft Rechtssicherheit im Umgang mit der Nutzung fremden Eigentums.
Unter welchen Voraussetzungen kann ein Eigentümer die Herausgabe einer von ihm überlassenen Sache zurückfordern?
Ein Eigentümer kann die Herausgabe einer Sache grundsätzlich dann zurückfordern, wenn der aktuelle Besitzer kein gültiges Recht hat, diese Sache zu behalten. Stellen Sie sich vor, jemand hat Ihnen ein Buch geliehen. Solange ein vereinbarter Zeitraum läuft oder ein anderer gültiger Grund besteht, das Buch zu behalten, darf derjenige es behalten. Erlischt jedoch dieses Recht, können Sie Ihr Buch als Eigentümer zurückfordern.
Dieses „Recht zum Besitz“ ist entscheidend. Es kann aus verschiedenen Vereinbarungen entstehen, beispielsweise einem Mietvertrag, der einem Mieter das Recht gibt, eine Wohnung gegen Zahlung zu nutzen. Ein weiteres Beispiel ist ein Leihvertrag, bei dem eine Sache unentgeltlich überlassen wird.
Auch wenn ein solches Recht ursprünglich bestand, kann es erlöschen, wodurch der Eigentümer die Sache zurückfordern kann. Bei einem Leihvertrag, der keine feste Dauer hat, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückverlangen. Ein Mietvertrag hingegen kann nur unter bestimmten Bedingungen gekündigt werden, etwa bei Nichtzahlung der Miete, wodurch das Besitzrecht des Mieters erlischt. Dieses Prinzip sichert das Eigentum und schützt das Recht des Eigentümers auf die volle Kontrolle über seine Sache.
Warum ist die Dokumentation von Zahlungen und Vereinbarungen bei mündlichen Abmachungen so entscheidend?
Die Dokumentation von Zahlungen und Vereinbarungen ist bei mündlichen Abmachungen entscheidend, weil mündliche Verträge zwar grundsätzlich gültig sind, derjenige, der sich darauf beruft, dies im Streitfall jedoch beweisen muss. Man kann es sich vorstellen wie bei einer mündlichen Verabredung: Wenn nachträglich Zweifel aufkommen, wer was zugesagt oder bezahlt hat, sind schriftliche Notizen oder Belege entscheidend, um Missverständnisse auszuräumen und die ursprüngliche Absprache zu belegen.
Ohne nachvollziehbare Belege können Behauptungen, beispielsweise über geleistete Mietzahlungen oder die genaue Art einer Vereinbarung, vor Gericht oft nicht bewiesen werden. Dies war im vorliegenden Fall der angebliche Mietvertrag zwischen Onkel und Nichte besonders deutlich. Da der Onkel seine behaupteten monatlichen Zahlungen nicht glaubhaft nachweisen konnte, zweifelte das Gericht an der Existenz eines Mietvertrages mit Zahlungsverpflichtung und wies seine Klage ab.
Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden, sollte man Zahlungen stets nachvollziehbar gestalten, idealerweise durch Banküberweisungen statt Bargeld. Wichtige Absprachen können durch schriftliche Notizen, E-Mails oder Nachrichten dokumentiert werden. Auch das Hinzuziehen von Zeugen kann hilfreich sein, um mündliche Vereinbarungen zu untermauern. Diese Praxis schützt nicht nur die Beteiligten vor Missverständnissen, sondern stellt auch sicher, dass ein Gericht eine gerechte Entscheidung auf Basis überprüfbarer Fakten treffen kann.
Welche Herausforderungen können bei der Überlassung von Wohnraum an Familienangehörige ohne schriftlichen Vertrag entstehen?
Bei der Überlassung von Wohnraum an Familienangehörige ohne schriftlichen Vertrag können erhebliche rechtliche Unsicherheiten und Beweisschwierigkeiten entstehen. Dies betrifft insbesondere die Frage, welche Art von Nutzungsverhältnis vorliegt und welche Rechte sowie Pflichten daraus resultieren.
Stellen Sie sich vor, zwei Fußballteams spielen ohne klare Regeln oder einen Schiedsrichter, der die Tore zählt. Jeder Spieler könnte behaupten, seine eigene Version der Spielregeln sei die richtige, und es gäbe keine objektive Möglichkeit, den wahren Stand des Spiels oder den Gewinner festzustellen. Genauso ist es bei mündlichen Vereinbarungen ohne schriftliche Dokumentation.
Ohne eine schriftliche Vereinbarung ist es für alle Beteiligten und insbesondere für ein Gericht schwierig festzustellen, ob es sich um einen Mietvertrag, einen Leihvertrag oder eine andere Form der Nutzung handelt. Die Unterscheidung ist jedoch entscheidend: Ein Mietvertrag erfordert in der Regel regelmäßige Zahlungen und ist nur unter bestimmten Gründen kündbar, während eine Leihe oft unentgeltlich ist und leichter beendet werden kann. Fehlen schriftliche Nachweise über getätigte Zahlungen oder getroffene Absprachen zur Dauer des Nutzungsverhältnisses, können Behauptungen einer Partei nur schwer bewiesen werden. Ein Gericht kann die Existenz eines Mietvertrags anzweifeln, wenn die behaupteten Mietzahlungen aufgrund der finanziellen Situation der Person als unglaubwürdig erscheinen.
Diese Herausforderungen zeigen deutlich, wie wichtig präzise und schriftlich festgehaltene Vereinbarungen sind, um Missverständnisse zu vermeiden und Rechtssicherheit für alle Parteien zu schaffen.
Wann erlischt das Recht einer Person, eine überlassene Sache weiter zu besitzen?
Das Recht, eine überlassene Sache zu besitzen, endet, sobald der zugrunde liegende Vertrag oder die Vereinbarung hierfür beendet ist. Dies gilt, wenn eine Person eine Sache, wie eine Wohnung, nicht mehr nutzen darf, weil der ursprünglich vereinbarte Grund für die Nutzung weggefallen ist.
Man kann es sich vorstellen wie bei einem geliehenen Buch aus der Bibliothek: Sobald die Ausleihfrist abgelaufen ist oder Sie das Buch zurückgeben müssen, weil jemand anderes es vorbestellt hat, erlischt Ihr Recht, es weiter zu behalten. Der Eigentümer, also die Bibliothek, kann es dann zurückverlangen.
Ein Recht zum Besitz kann auf verschiedene Weisen enden. Dies geschieht zum Beispiel, wenn eine vereinbarte Frist abläuft, wie bei einem zeitlich befristeten Vertrag. Es erlischt auch, wenn der Vertrag wirksam gekündigt wird, sei es eine Leihe oder ein Mietvertrag. Bei einer Leihe kann dies oft jederzeit geschehen, wenn keine feste Dauer vereinbart wurde. Bei einem Mietvertrag bedarf es meist eines triftigen Grundes für eine Kündigung, etwa bei nicht erbrachten Leistungen. Das Recht zum Besitz erlischt auch, wenn der ursprüngliche Grund für die Überlassung entfällt oder der vereinbarte Zweck erreicht wurde.
Sobald das Besitzrecht erloschen ist, kann der Eigentümer die Herausgabe der Sache verlangen. Der übergeordnete Zweck dieser Regeln ist es, klare Verhältnisse über die Nutzung von Eigentum zu schaffen und Eigentümern die Kontrolle über ihre Sachen zu sichern.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Gegenklage
Eine Gegenklage ist eine eigene Klage der beklagten Partei innerhalb desselben Gerichtsverfahrens, um eigene Ansprüche gegen den ursprünglichen Kläger geltend zu machen. Sie ermöglicht es, in einem Prozess nicht nur die Abweisung der ursprünglichen Klage zu verlangen, sondern auch eigene Forderungen gerichtlich durchzusetzen. Dies spart Zeit und Kosten, da nicht zwei separate Verfahren geführt werden müssen.
Beispiel: Die Nichte forderte in einer eigenen Gegenklage die Räumung der Wohnung und deren Herausgabe durch den Onkel, nachdem dieser sie auf Wiedereinräumung des Besitzes verklagt hatte.
Herausgabeanspruch des Eigentümers
Der Herausgabeanspruch des Eigentümers ist das Recht, das es dem Eigentümer einer Sache erlaubt, diese von jemandem zurückzufordern, der sie ohne ein gültiges Recht besitzt. Dieses grundlegende Prinzip des Zivilrechts schützt das Eigentum und stellt sicher, dass der Eigentümer die Kontrolle über seine Sache behält, es sei denn, jemand anderes hat ein berechtigtes Nutzungsrecht.
Beispiel: Die Nichte als Eigentümerin der Wohnung machte einen Herausgabeanspruch geltend, weil sie meinte, der Onkel habe kein Recht mehr, die Wohnung zu besitzen, nachdem das Nutzungsverhältnis ihrer Ansicht nach beendet war.
Leihvertrag
Ein Leihvertrag ist eine Vereinbarung, bei der Sie eine Sache wie eine Wohnung von jemandem unentgeltlich – also kostenlos – nutzen dürfen. Im Gegensatz zum Mietvertrag ist hier keine Gegenleistung vorgesehen. Der Verleiher kann die Sache in der Regel jederzeit zurückfordern, wenn keine feste Dauer vereinbart wurde.
Beispiel: Die Nichte behauptete, sie habe ihrem Onkel die Wohnung lediglich als Leihe zur Verfügung gestellt, und dieses Leihverhältnis ordnungsgemäß beendet.
Mietvertrag
Ein Mietvertrag ist eine Vereinbarung, bei der Sie eine Sache – wie eine Wohnung – gegen regelmäßige Bezahlung für eine bestimmte Zeit nutzen dürfen. Er regelt die Rechte und Pflichten von Mieter und Vermieter, insbesondere den Mieterschutz, der eine Kündigung durch den Vermieter nur unter bestimmten, gesetzlich festgelegten Voraussetzungen erlaubt.
Beispiel: Im Fall behauptete der Onkel, er habe mit seiner Nichte einen mündlichen Mietvertrag über die Wohnung geschlossen und monatlich 900 Euro gezahlt, woraus er sein Recht zum Besitz ableitete.
Recht zum Besitz
Das Recht zum Besitz ist die Berechtigung einer Person, eine Sache – zum Beispiel eine Wohnung – legal zu nutzen oder innezuhaben, obwohl sie nicht deren Eigentümer ist. Es dient als Schutzschild gegen den Herausgabeanspruch des Eigentümers: Nur wer ein solches Recht hat (z.B. aus einem Miet- oder Leihvertrag), darf die Sache behalten. Erlischt dieses Recht, kann der Eigentümer die Sache zurückverlangen.
Beispiel: Der Streit im Fall drehte sich darum, ob der Onkel ein fortbestehendes Recht zum Besitz an der Wohnung hatte, sei es aufgrund eines behaupteten Mietvertrags oder eines eingeräumten Leihverhältnisses.
vorläufig vollstreckbar
Ein Urteil, das für „vorläufig vollstreckbar“ erklärt wurde, kann vom Gewinner sofort umgesetzt werden, auch wenn der Verlierer noch Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen kann. Dieser gerichtliche Beschluss soll verhindern, dass der Verlierer durch das Einlegen von Rechtsmitteln (wie Berufung oder Revision) die Umsetzung des Urteils unnötig verzögert. Es dient der schnellen Rechtsdurchsetzung, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
Beispiel: Das Urteil bezüglich der Räumung und Herausgabe der Wohnung wurde für vorläufig vollstreckbar erklärt, was bedeutete, dass die Nichte es umsetzen konnte, auch wenn der Onkel noch Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen sollte.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- Eigentumsherausgabeanspruch (§ 985 BGB)
Ein Eigentümer kann seine Sache von jedem zurück, der sie ohne Recht besitzt.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Nichte war unstreitig die Eigentümerin der Wohnung und hatte daher grundsätzlich das Recht, diese von ihrem Onkel zurückzufordern, es sei denn, der Onkel hatte ein eigenes fortbestehendes Recht, die Wohnung zu behalten. - Recht zum (§ 986 BGB)
Wer eine Sache besitzt, darf diese nur behalten, wenn er ein gültiges Recht dazu hat, zum Beispiel aufgrund eines Vertrages.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Onkel musste beweisen, dass er ein fortbestehendes Recht hatte, die Wohnung zu nutzen, um die Herausgabe an die Nichte zu verhindern. Ohne ein solches Recht konnte die Nichte die Wohnung zurückverlangen. - Mietvertrag (§ 535 BGB) und Leihvertrag (§ 598 BGB)
Ein Mietvertrag erlaubt die Nutzung einer Sache gegen regelmäßige Zahlung, während ein Leihvertrag die Nutzungentgeltlich gestattet.
→ edeutung im vorliegenden Fall: Ob die dem Onkel vermietet oder nur geliehen, war die zentrale Streitfrage, da die Art des Vertrages maßlich bestimmte, ob und wie die Nichte das Nutzungsverhältnis beenden. - Beendigung von Gebrauchsüberlassungsverträgen (z.B. § 604 BGB, § 543 BGB)
Verträge über die Nutzung einer Sache können unter bestimmten Voraussetzungen, wie einer Kündigung oder dem Ablauf einer Frist, beendet werden.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht stellte fest, dass das Nutzungsrecht des Onkels jedem Fall erloschen war, entweder durch die fristlose Kündigung einer potenziellen Leihe oder durch die berechtigte fristlose Kündigung eines Mietvertrags aufgrund nicht nachweisbarer Mietzahlungen. - Beweislast im Zivilprozess (Allgemeiner Rechtsgrundsatz)
Jede Partei muss vor Gericht die Tatsachen beweisen, die ihre Behauptung stützen und auf denen ihr beruht.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Onkel konnte seine Behauptung, monatlich 900 Euro Miete gezahlt zu haben, nicht glaubhaft belegen, für das Gericht entscheidend war, um die Existenz eines wirksamen Mietvertrags und somit sein Recht zum Besitz zu verneinen.
Das vorliegende Urteil
AG Bottrop – Az.: 12 C 11/25 – Urteil vom 05.05.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.